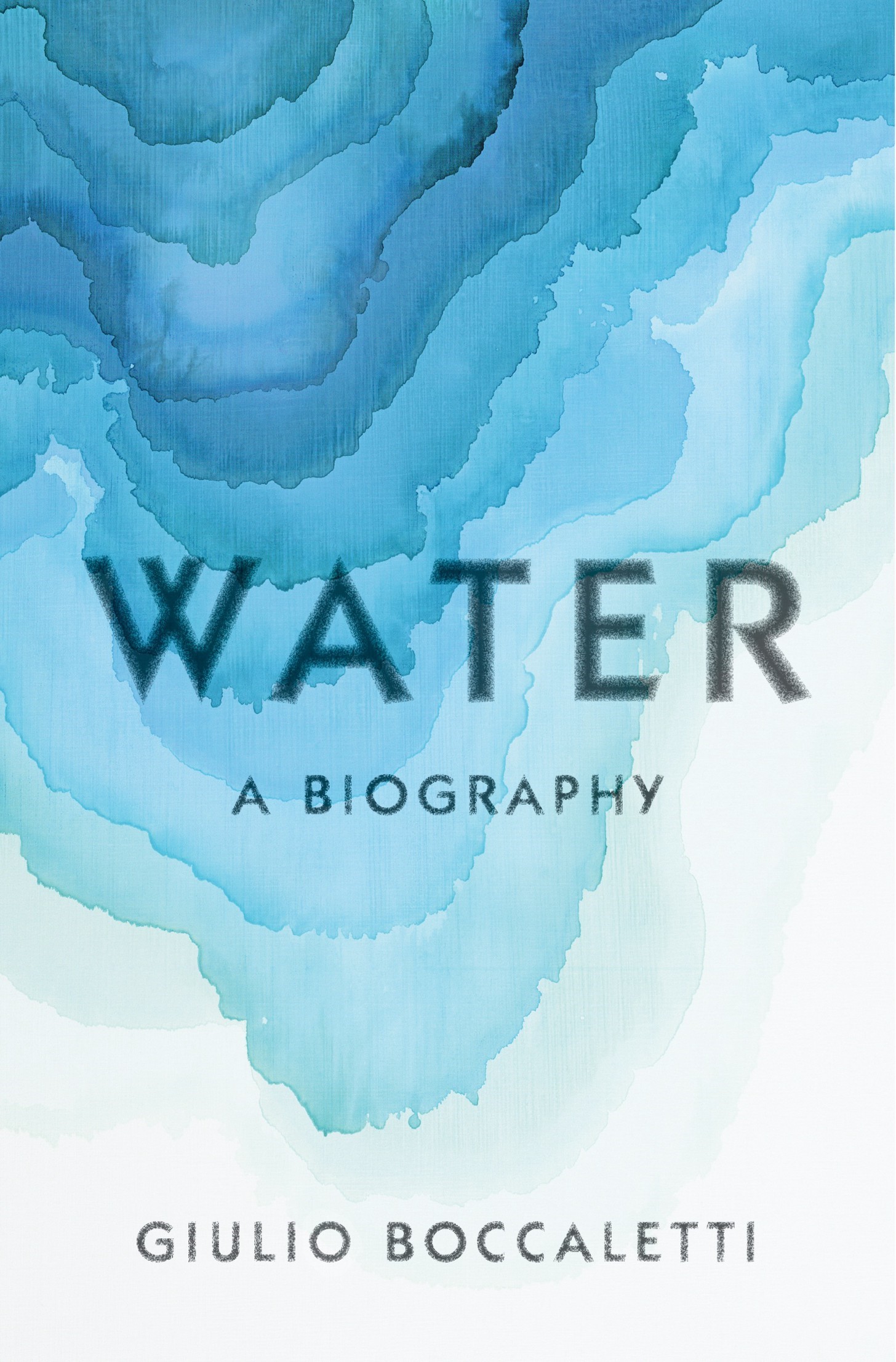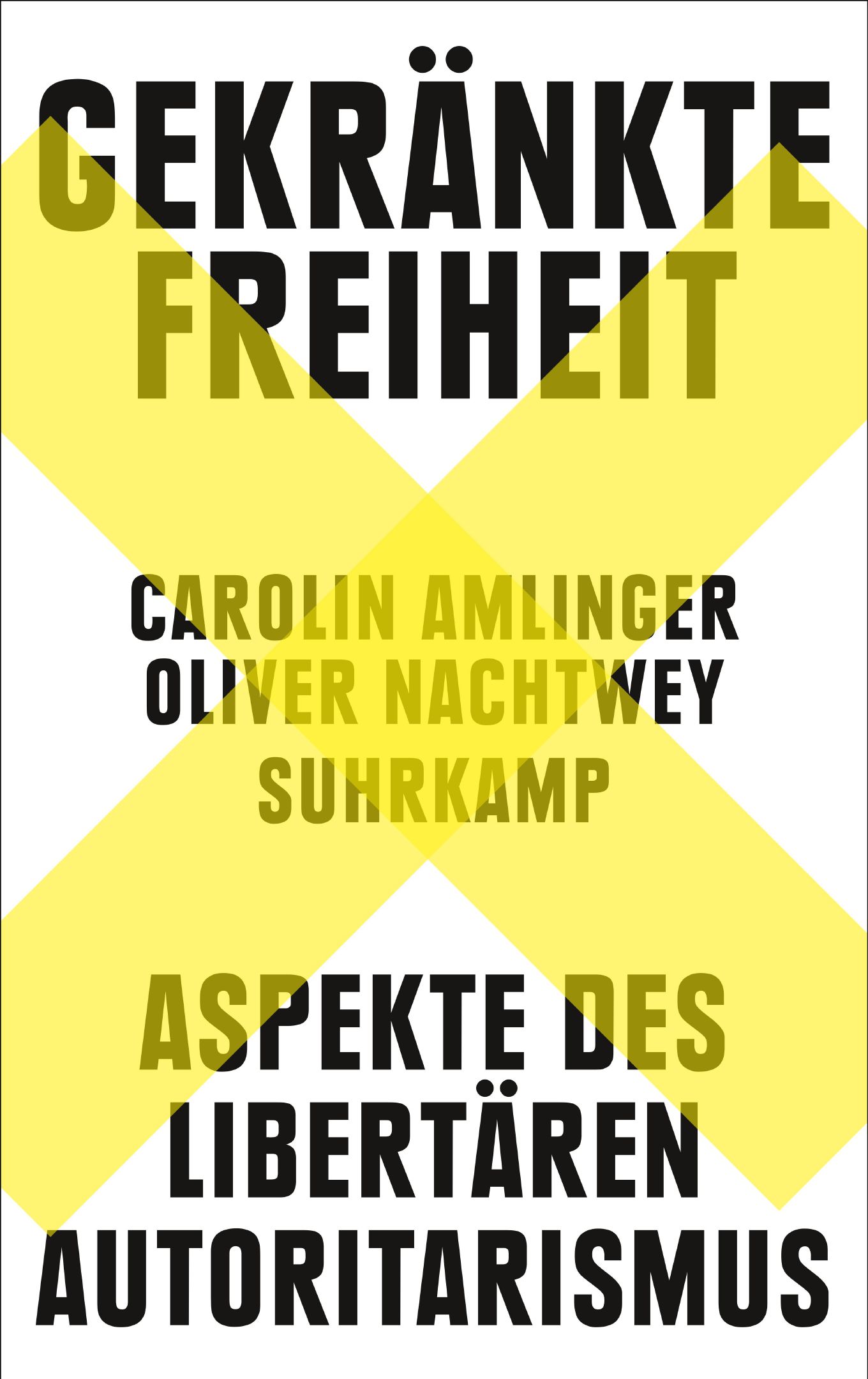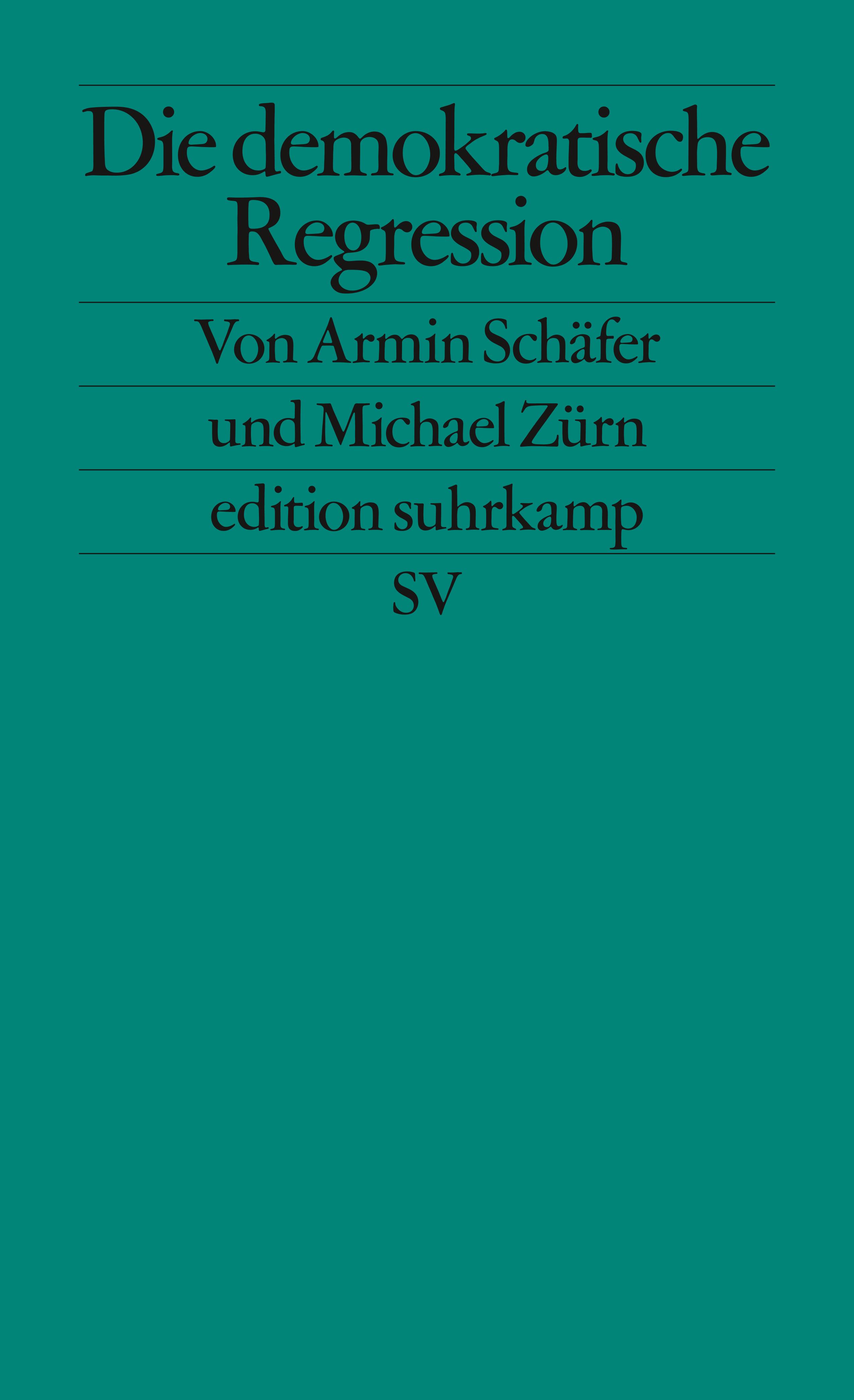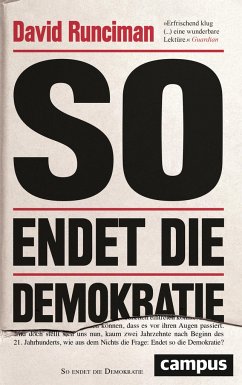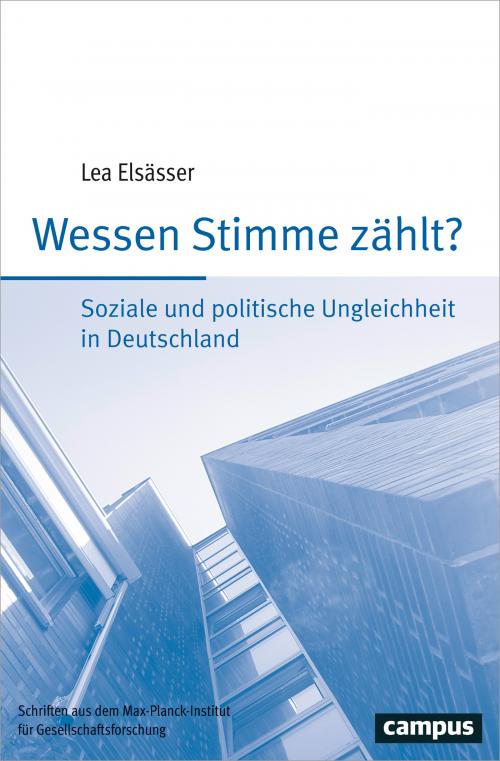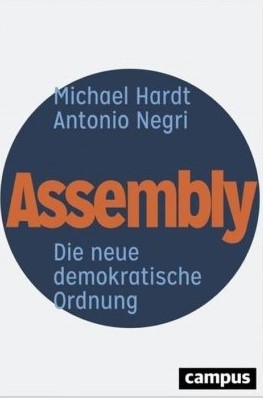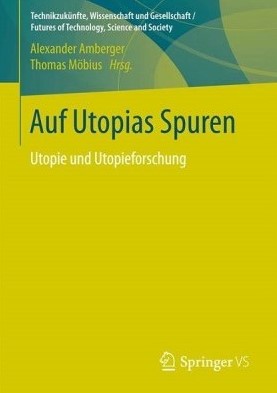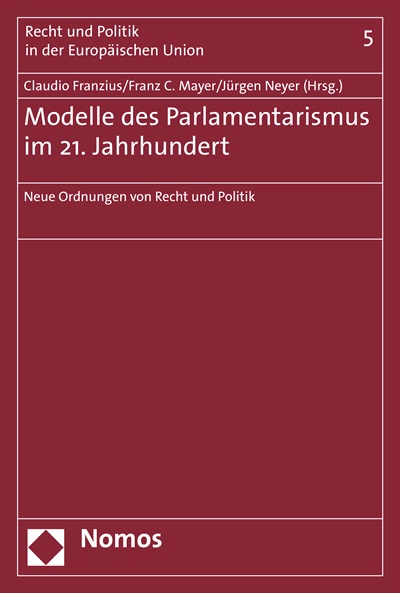Foto © Renner-Institut
Ulrich Menzel: Wendepunkte: Am Übergang zum autoritären Jahrhundert
Ulrich Menzel sieht die Welt in einer Phase des hegemonialen Übergangs „vom liberalen amerikanischen zum autoritären chinesischen Jahrhundert“. Diese Epoche sei durch die Anarchie der Staatenwelt sowie die Rückkehr des Autoritären und des Krieges in Europa geprägt. Rezensentin Tamara Ehs sieht in dem Buch eine „Collage des enormen Wissensfundus von Ulrich Menzel“, der die großen Diskussionen der letzten Jahrzehnte in einen zeitgenössischen Kontext setzt, um so die Wendepunkte einer Welt im Umbruch zu verstehen.
Branko Milanović: Visions of Inequality. From the French Revolution to the End of the Cold War
Für unsere Rezensentin Tamara Ehs hat Branko Milanović in seinem jüngsten Buch eine „unverzichtbare Chronik für unser Verständnis von Ungleichheit“ vorgelegt. Milanovićs kontextualisierende Untersuchung der Ideen einschlägiger Ökonomen führt von Francois Quesnay über Karl Marx bis zum Kalten Krieg, in der die Ungleichheitsforschung laut Milanović aufgrund einer „kulturellen Hegemonie der Reichen“ vernachlässigt wurde. Der Fokus auf sozioökonomische Ungleichheit sei, so fügt Ehs hinzu, insbesondere für die aktuellen Debatten um die Repräsentationskrise der Demokratie anschlussfähig.Giulio Boccaletti: Water. A Biography
Welche Rolle spielte Wasser bei der Begründung von Gemeinwesen? Giulio Boccaletti fokussiert auf die Republik als Staatsform, in der Individualinteressen und kollektives Handeln ideal zusammenwirkten. Sein Buch sei weniger eine wissenschaftliche Abhandlung als vielmehr eine Erzählung über das Römische Reich, China und den Kapitalismus, so unsere Rezensentin Tamara Ehs: Begründet „auf der großartigen Idee, die Geschichte der Staaten und insbesondere jene der Republik vom Wasser her zu betrachten“, lasse es gerade politikwissenschaftliche Leser*innen mit offenen Fragen zurück.
Carolin Amlinger, Oliver Nachtwey: Gekränkte Freiheit. Aspekte des libertären Autoritarismus
Die Soziolog*innen Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey entwickeln in ihrem Buch „Gekränkte Freiheit“ anhand biographischer Interviews die Sozialfigur der libertären Autoritären. Im Gegensatz zum unterwürfigen autoritären Charakter, wie ihn die Frankfurter Schule einst entwarf, zeichneten sich libertäre Autoritäre durch einen zügellosen Freiheitsbegriff und eine Maximalvorstellung von Autonomie aus. Verantwortlich für diesen Wandel seien die Verwerfungen kapitalistischer Gesellschaften, die das Individuum enttäuscht und von gesellschaftlichen Solidaritäten entkoppelt zurückließen. Rezensentin Tamara Ehs hält die Milieubeschreibung und theoretische Herleitung der libertären Autoritären für überzeugend.
Armin Schäfer / Michael Zürn: Die demokratische Regression
Was macht den autoritären Populismus für Bürger*innen so attraktiv? Armin Schäfer und Michael Zürn erklären dies mit tatsächlichen Problemen liberaler Demokratien: Populist*innen dienten als Lackmustest, da sie wunde Punkte von (Un-)Gleichheit und (fehlender) parlamentarischer Repräsentation adressierten, so auch unsere Rezensentin Tamara Ehs. Diskutiert werde dabei die Gefährdung der, an sich als gefestigt geltenden, Demokratien in Europa vor dem Hintergrund jüngster Krisen – analytisch wird all dies in Datensätze und Ergebnisse verschiedener Demokratieindizes eingebettet.
Yascha Mounk: Der Zerfall der Demokratie. Wie der Populismus den Rechtsstaat bedroht
Während die Demokratie früher weitgehend stabil gewesen sei, erlebten wir derzeit eine „Ära der Instabilität“, schreibt der Politikwissenschaftler Yascha Mounk in seinem Buch „Der Zerfall der Demokratie“, das Tamara Ehs rezensiert hat. Es gelte sie krisenfest zu machen, „etwas gegen die strukturellen Antriebskräfte des Populismus“ zu unternehmen. Als „Gegenmittel“ empfehle Mounk einen „inklusiven Patriotismus“, eine reformierte Steuerpolitik, um „grundlegende Elemente des Wohlfahrtsstaates“ wieder einführen zu können, sowie die Stärkung der politischen Bildung, denn sie sei ein „Bollwerk gegen autoritäre Versuchung“.
Anne Applebaum: Die Verlockung des Autoritären. Warum antidemokratische Herrschaft so populär geworden ist
In „Die Verlockung des Autoritären“ zeichne Anne Applebaum im journalistischen Stil nach, wie sich Angehörige konservativer Bildungseliten früherer Mitte-rechts-Parteien ins Autoritäre gewandelt haben, so Rezensentin Tamara Ehs. Da die Autorin persönlichen Zugang zu diesen Kreisen habe, erlebten die Leser*innen über private Erzählungen die Polarisierung und Radikalisierung der konservativen Eliten mit und erhielten Einblick in deren persönliche Verbindungen. Entstanden sei ein persönliches Zeitdokument, aber kein politikwissenschaftliches Buch, so Ehs.
Jens Kersten / Stephan Rixen: Der Verfassungsstaat in der Corona-Krise. Analysen staatlichen Handelns
Die Rechtswissenschaftler Jens Kersten und Stephan Rixen legen dar, wie der Verfassungsstaat auch und gerade in der Krise funktioniert. „Zielkonflikte zwischen dem vorsorgenden Sozialstaat und dem freiheitsverpflichtenden Rechtsstaat“ seien „an der Tagesordnung und kein Grund, die Nerven zu verlieren“, so die Autoren. Es komme vielmehr darauf an, wie der Staat auf Rechtsverletzungen reagiere. Der deutsche Verfassungsstaat verfüge über alle notwendigen Voraussetzungen, in der Coronakrise nicht nur zu bestehen, sondern sogar gestärkt aus ihr hervorzugehen.David Runciman: So endet die Demokratie. Faktoren ihrer Bedrohung
David Runciman attestiert der westlichen Demokratie eine Midlife Crisis und fragt, „ob es sinnvoll wäre, die Demokratie durch etwas Besseres zu ersetzen“. Der britische Politologe stellt die Möglichkeiten dar, an denen die Demokratie zugrunde gehen könnte – nämlich Putsch, Katastrophe oder technologische Übernahme. Mark Zuckerberg sei für die Demokratie die größere Bedrohung als Donald Trump, weil Trump immerhin abgewählt werden könne: „Wahrscheinlich sieht das Schicksal der Demokratie so aus, dass die Trumps kommen und gehen und die Zuckerbergs weitermachen werden“.
Julia Cagé: The Price of Democracy. How Money Shapes Politics and What to Do about It
Vom Ideal des One man – one vote seien manche Demokratien heute entfernter denn je; vielmehr regiere aufgrund von Parteispenden das Motto One Euro – one vote, kritisiert die französische Ökonomin Julia Cagé. Sie zeigt in ihrer ländervergleichenden Langzeitstudie auf, wie sich wirtschaftliche Ungleichheiten in politisch ungleiche Responsivität übersetzen. Wer über genügend finanzielle Mittel verfüge, dessen Stimme zähle mehr. Die Autorin bietet nicht nur einen gründlichen Überblick über das Verhältnis von Geld und Politik in westlichen Demokratien, sondern zeigt auch konkrete Wege der Regulierung auf.
Stephan Lessenich: Grenzen der Demokratie. Teilhabe als Verteilungsproblem
Auf nur wenigen Seiten räumt Stephan Lessenich mit der Klage über die Krise der Demokratie gründlich auf und bietet eine Gegenerzählung zu der verbreiteten Mystifizierung der „guten alten Zeit“. Richteten wir den Blick nämlich auf jene, die in den fetten Jahren eine demokratische Schattenexistenz führten – Frauen, Migranten, Nichterwerbstätige – müssten wir uns eingestehen: Wir sind nie so demokratisch gewesen. Lessenich ordnet den Kampf um die Demokratie in vier Arenen: Klassen, gesellschaftlicher Status (nach Geschlecht, Bildung, Alter), Staatsbürgerschaft sowie Natur/Umwelt.
Toralf Stark: Demokratische Bürgerbeteiligung außerhalb des Wahllokals. Umbrüche in der politischen Partizipation seit den 1970er-Jahren
Toralf Stark fragt, wodurch sich politisches Handeln bestimmt. Hierfür untersucht er das Partizipationsverhalten von den 1970er-Jahren bis zum Jahr 2008 in sieben westlichen Ländern. Im Mittelpunkt steht die sozialökonomische Dimension. Die Analyse bestätigt den Trend, dass sozial Schlechtergestellte sich sukzessive von der etablierten Politik abwenden, weil sie sich dort nicht mehr vertreten fühlen. Zur Diskussion stehe, wie sich das schwindende Vertrauen in die Institutionen auf die Beteiligungsneigung und die Auswahl der Partizipationsformen auswirkt.
Der Fall Kavanaugh oder: Backlash in the USA. Neubesetzung des Supreme Court beendet den „progress without politics“

Der Trumpismus hat sich nach der Besetzung zweier Stellen im Supreme Court mit relativ jungen konservativen Richtern erfolgreich festgesetzt. Diese Entwicklung werden in Zukunft insbesondere die sozialen Bewegungen zu spüren bekommen, schreibt Tamara Ehs in ihrer Analyse: Es waren vor allem engagierte Gruppen und NGOs im Bereich der Frauen- und Menschenrechte oder auch des Umweltschutzes, die in den vergangenen Jahrzehnten mittels strategischer Prozessführung eine politische Liberalisierung erreichten – häufig ohne eine durch Wahlen mehrheitsfähige gesellschaftliche Verankerung. In Zukunft aber muss ihre Mobilisierung im parlamentarischen Raum erfolgreich sein.
Lea Elsässer: Wessen Stimme zählt? Soziale und politische Ungleichheit in Deutschland
„Wer einer unteren sozialen Klasse angehört, hat eine geringere Chance darauf, dass seine oder ihre Anliegen politisch umgesetzt werden“, lautet das Argument von Lea Elsässer, die mit ihrer Dissertation nachweist, dass in Deutschland eine starke soziale Schieflage in der politischen Repräsentation besteht. So zeigt ihre Analyse sozialpolitischer Entscheidungen von 1980 bis 2013, dass diese deutlich zugunsten der oberen Berufsgruppen ausfielen. Die politischen Anliegen der unteren sozialen Schichten hingegen wurden im Untersuchungszeitraum von keiner Regierungspartei in den politischen Prozess getragen.
Michael Hardt / Antonio Negri: Assembly. Die neue demokratische Ordnung
Michael Hardt und Antonio Negri unternehmen eine Tour durch die politische (Ideen-)Geschichte, um für soziale Bewegungen zu lernen: Wie kann Führung ohne Zentralisierung gelingen? In welchem Verhältnis stehen Strategie, Taktik und Organisation zueinander? Wie können die Demokratisierung der Gesellschaft und Partizipation aller nicht nur Ziel, sondern bereits Weg sein? Die Analyse überzeugt unsere Rezensentin Tamara Ehs allerdings nicht, denn weder wird die Grundvoraussetzung einer erfolgreichen Versammlung diskutiert noch werden deren bereits bestehende Erscheinungsformen ausgeleuchtet.
Alexander Amberger / Thomas Möbius (Hrsg.): Auf Utopias Spuren. Utopie und Utopieforschung
Utopien haben in Krisenzeiten Hochsaison und Krisen gibt es derzeit genug. Somit sind Sehnsucht und Suche nach Alternativen wieder im Fokus der Aufmerksamkeit. Amberger und Möbius bieten einen grundlegenden Überblick, wie alternative Gesellschaftsentwürfe die Ideengeschichte sowie auch die politische Praxis beeinflusst haben. Von Konfuzius über Benedetto Croce, von der Arbeiterbewegung über das Rote Wien bis zur DDR, vom wilhelminischen Deutschland über den Film Avatar bis zur zeitgenössischen Architektur spannen sie den Bogen, um den Kern jeglicher Utopie herauszuarbeiten: ihr emanzipatives Potenzial.
Jan-Werner Müller: Was ist Populismus? Ein Essay
Was ist überhaupt demokratisch? Von dieser Frage ausgehend widmet sich Jan-Werner Müller dem Populismus. Über den Pluralismus als Merkmal der Demokratie gelangt er zu der These, dass Populismus per se antipluralistisch und „der Tendenz nach zweifelsohne antidemokratisch ist“. Es ist folglich auch nicht wesentlich, wer die Wählerschichten der Populisten sind und welche Gemeinsamkeiten unter ihnen ausfindig zu machen wären. Für Müller definiert sich der Populist nicht über seine Anhängerschaft, sondern über drei Herrschaftstechniken, die er anwendet: Inbesitznahme des Staates, Klientelismus und Diskreditierung jeglicher Opposition.
Claudio Franzius / Franz C. Mayer / Jürgen Neyer (Hrsg.): Modelle des Parlamentarismus im 21. Jahrhundert
Welche Wege für den Parlamentarismus angesichts des Versuchs einer Transnationalisierung der Massendemokratie gangbar sein könnten, wird in dem von Claudio Franzius et al. publizierten Sammelband erörtert. Den Ausgangspunkt bildet dabei die historische Analyse von Hauke Brunkhorst. Er erinnert daran, dass Demokratie und Parlamentarismus nicht immer gemeinsam gedacht wurden und ursprünglich hinsichtlich ihrer Einforderung einer „Solidarität der Rechtsgenossen“ schon gar nicht „an die Form des modernen Nationalstaats gebunden“ (45) waren.