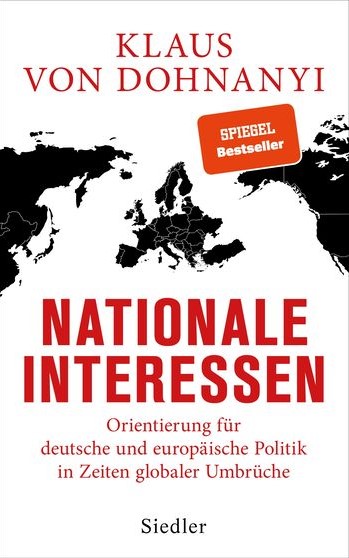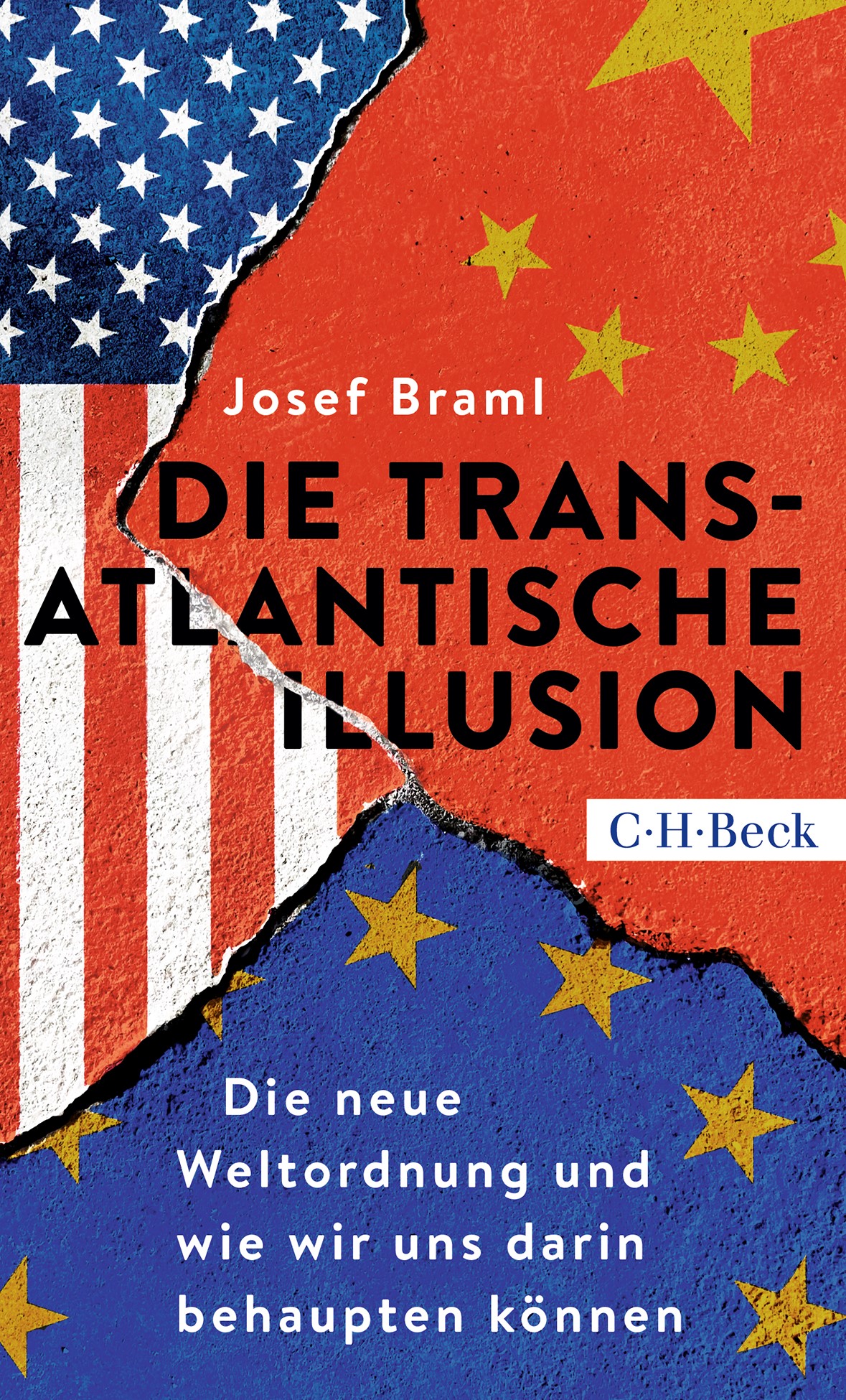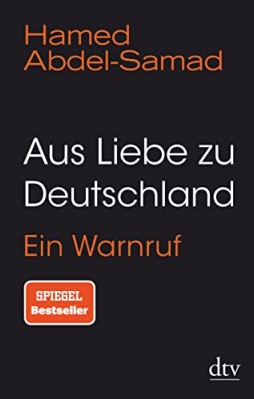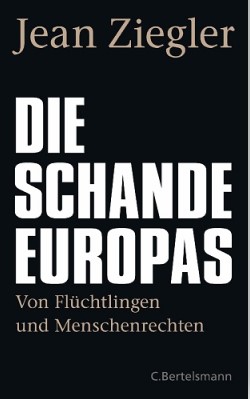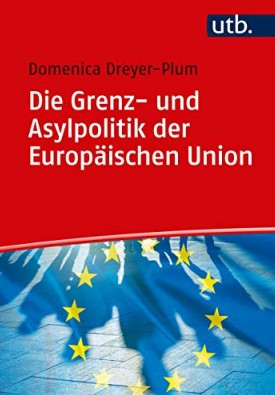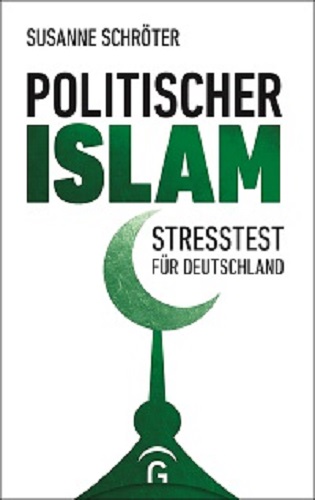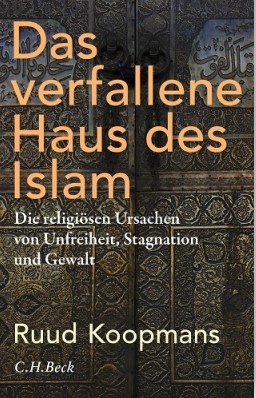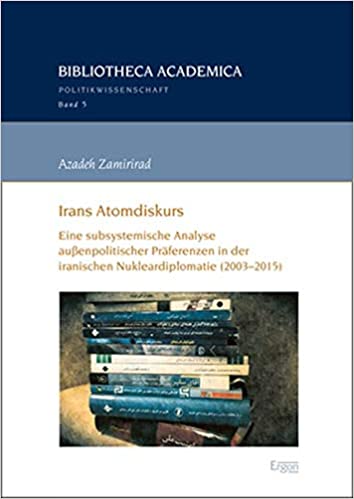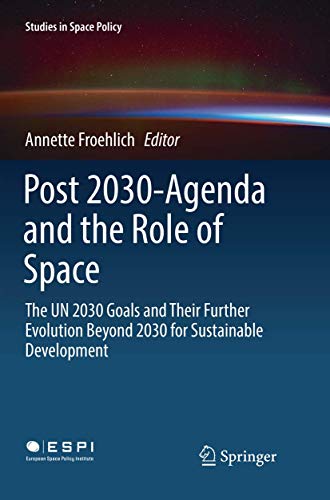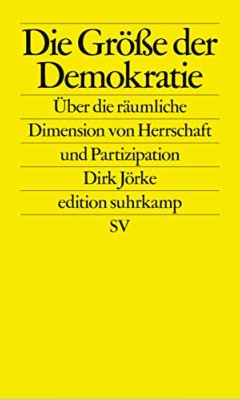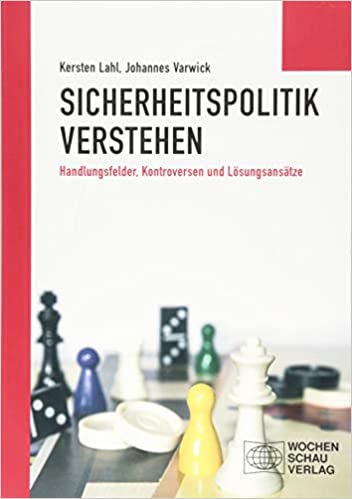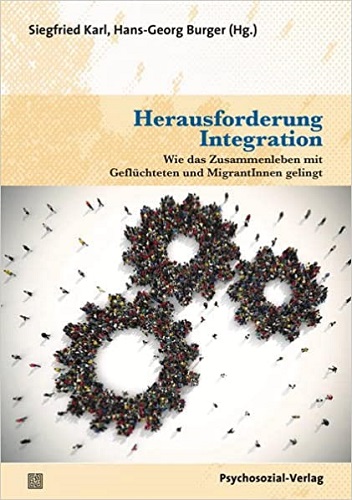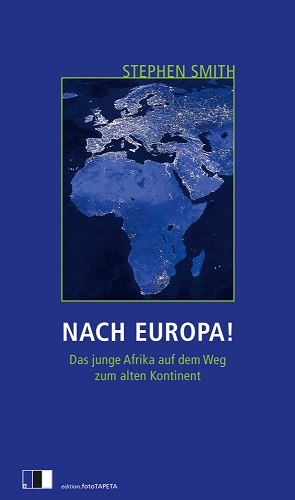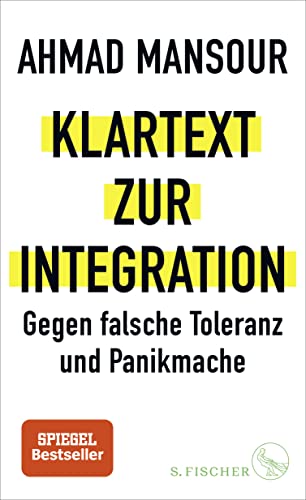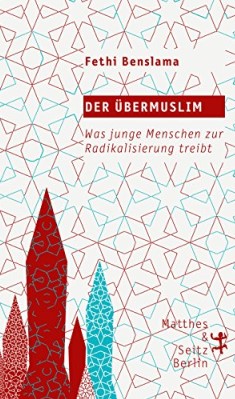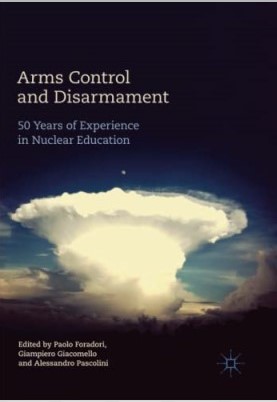Carlo Masala: Weltunordnung. Die globalen Krisen und die Illusionen des Westens
Carlo Masala argumentiert, dass die Welt im 21. Jahrhundert in Unordnung geraten sei. Er führt hierzu auch an, dass der Versuch des Westens, Demokratie zu verbreiten, gescheitert sei und westliche Interventionen stattdessen zu Chaos und Instabilität geführt hätten. Dabei stellt er die Effektivität übergeordneter Institutionen in Frage und betont, dass Stabilität nur dann hergestellt werden könne, wenn man eine realistische Außenpolitik innerhalb von „Koalitionen der Willigen“ (155) verfolgt. Wahied Wahdat-Hagh hat das Buch rezensiert.
Jannis Jost, Joachim Krause (Hrsg.): Jahrbuch Terrorismus 2019-2021
Der Fokus dieses inhaltlich sehr dichten und stringent abgefassten Bandes liege auf rechtsextremistischen Gewalttaten, so Wahied Wahdat-Hagh. Ergänzt werde dies durch Beiträge zu den aktuellen Entwicklungen von islamistischem und linkem Terrorismus. Während globale Radikalisierungsphänomene vor allem mit statistischen Methoden fassbar werden, zeigten Analysen für Europa, dass dort meist Einzeltäter*innen aus unterschiedlichsten Beweggründen und ohne feste Organisationsbindung aktiv würden, so ein Fazit des Buchs.
Klaus von Dohnanyi: Nationale Interessen. Orientierung für deutsche und europäische Politik in Zeiten globaler Umbrüche
Klaus von Dohnanyi fordert die Ausrichtung deutscher und europäischer Politik nach Maßgabe nationaler Interessen. Hierzu entwickelt er Thesen zum Verhältnis zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten konzeptionell auf Grundlage von Identität, Wertegemeinschaft und demokratischer Legitimation: Basis bleibe der soziale, wettbewerbsfähige Nationalstaat. Auch kritisiert er die deutsche Außenpolitik in Bezug auf die USA, China und Russland. Unseren Rezensenten Wahied Wahdat-Hagh vermögen die mit „strikter Redundanz“ vorgetragenen Grundideen indes nicht zu überzeugen.
Josef Braml: Die transatlantische Illusion. Die neue Weltordnung und wie wir uns darin behaupten können
Josef Braml zeichnet ein kritisches Lagebild der transatlantischen Partnerschaft, deren Herausforderungen und Probleme durch den Angriffskrieg auf die Ukraine lediglich akzentuiert, aber nicht völlig verändert worden seien: Im Fokus stünden dabei einerseits die hegemonialen USA und Europa, dann die inneren und äußeren Dimensionen ihres (Nicht-)Handelns sowie die Verflechtungen mit Herausforderern und Partnern, so Wahied Wahdat-Hagh. Staatsinteressen wolle der Autor ohne Verklärungen analysieren und so verdeutlichen, was die Europäer*innen für ihre Souveränität in Angriff nehmen sollten.
Extremismus, Terrorismus, Rassismus, Antisemitismus und Hass. Neue Monografien zu Hintergründen, Entstehung und demokratischen Antworten

Wahied Wahdat-Hagh bespricht drei aktuelle Werke zum Thema Extremismus, die den Gegenstand auf unterschiedlichen Ebenen angehen: Während Armin Pfahl-Traughbers „Extremismus und Terrorismus in Deutschland. Feinde der pluralistischen Gesellschaft“ aus der Theoriebildung auf die genannten Phänomene blickt, gewährt der Sammelband „Nach dem NSU. Ergebnisse und Konsequenzen für die Polizei“ von Christoph Kopke Einblicke darin, welche Rolle die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus in der Ausbildung von Polizeibeamt*innen spielt. Ahmad Mansours Buch „Solidarisch sein! Gegen Rassismus, Antisemitismus und Hass“ wiederum schildert dessen persönliches Erleben von Rassismus und Extremismus und sein praktisch ausgerichtetes Vorgehen dagegen.
Hamed Abdel-Samad: Aus Liebe zu Deutschland. Ein Warnruf
Hamed Abdel-Samad fragt, wie es in der Bundesrepublik zur vergifteten Streitkultur und zum Schweigen der Menschen in der Mitte der Gesellschaft kam: Ist die Meinungsfreiheit in Gefahr oder glaubten die Menschen hierzulande schlicht nicht mehr an Freiheit und Demokratie? Während Deutschland weiter Migranten und Geflüchtete anziehe, goutierten viele eine Willkommenskultur, täten eine Leitkultur jedoch vielfach als dumpf, nationalistisch und rassistisch ab. Anhand solcher Fragen diskutiert der Autor eigene Thesen zu einem deutschen Identitätstrauma.
Christoph Butterwegge: Die zerrissene Republik. Wirtschaftliche, soziale und politische Ungleichheit in Deutschland
Christoph Butterwegge sieht die Bundesrepublik infolge wachsender Armut und sozialer Ungleichheit zerrissen. In kritischer Auseinandersetzung mit einschlägigen theoretischen Ansätzen macht er deutlich, wie in der westdeutschen Nachkriegssoziologie die als marxistisch verpönten Termini wie Klasse beziehungsweise Klassengesellschaft entschärft wurden. Seit Beginn des neuen Jahrtausends werde Armut daher auf individuelles Verhalten reduziert, statt die zunehmende neoliberale Spaltung der Gesellschaft in arm und reich auf den Interessensgegensatz von Kapital und Arbeit zurückzuführen.
Jean Ziegler: Die Schande Europas. Von Flüchtlingen und Menschenrechten
Jean Ziegler, Vizepräsident des Beratenden Ausschusses des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen, macht anhand von zahlreichen Fallbeispielen auf die Menschenrechtsverletzungen in den Hotspots der griechischen Ägäisinseln aufmerksam. Selbst im Mai 2019 nach Lesbos gereist, spricht sich der Autor nicht prinzipiell gegen Rückführungen aus, wohl aber dezidiert für das Recht, einen Asylantrag stellen zu können. Neben dem geltenden EU-Asylrecht beanstandet er daher die Strategie sogenannter Push-Back-Operationen seitens der türkischen und griechischen Küstenwachen sowie FRONTEX.
Domenica Dreyer-Plum: Die Grenz- und Asylpolitik der Europäischen Union
Domenica Dreyer-Plum widmet sich den Grundfragen der Asyl- und Grenzpolitik der Europäischen Union. Sie zeichnet nach, wie der Schengen-Raum progressiv infolge vieler Integrationsschritte als Raum der Freiheit und Sicherheit für EU-Bürger*innen gewachsen ist. Insbesondere die Grenzpolitik strebe danach, diesen Raum „gegenüber Dritten“ abzusichern. Die Autorin benennt daher kritisch Probleme und Herausforderungen, die unter anderem im Kontext von Frontex, sowie in aktuellen Verhandlungen über eine dauerhafte Verteilungsquote für Asylsuchende in der Union bestehen.
Susanne Schröter: Politischer Islam. Stresstest für Deutschland
Susanne Schröter, Leiterin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam, beschreibt den globalen Siegeszug des politischen Islam und möchte mit ihrem Buch Hintergrundwissen zur Einordnung von muslimischen Vereinigungen vermitteln. Anhand vieler Beispiele und Studien informiert sie über die Herausbildung islamistischer Netzwerkstrukturen sowie der Verbreitung von Islamismus, Antisemitismus und Gewalt insbesondere unter Jugendlichen. Der politische Islam sei eine totalitäre Ideologie, der mit den Mitteln der Demokratieerziehung begegnet werden müsse.
Polarisierung und Desinformation. Was muss eine Demokratie aushalten?

Wie steht es um die Zukunft der Demokratie, wie wird Demokratie destabilisiert und was muss sie aushalten? Gibt es überhaupt Wahrheit und Unabhängigkeit? Mit diesen Fragen beschäftigen sich aus unterschiedlichen Perspektiven Peter Pomerantsev, der am Institute of Global Affairs an der London School of Economics forscht, und Rahel Süß, die unter anderem an der Universität Wien politische Theorie lehrt. Beide machen sich Gedanken über die Gegenwart und Zukunft der Demokratie und bieten sich ergänzende Einsichten und Denkanstöße.
Ruud Koopmans: Das verfallene Haus des Islam. Die religiösen Ursachen von Unfreiheit, Stagnation und Gewalt
Einen Hauptgrund dafür, dass die „islamische Welt in den letzten fünfzig Jahren an fast allen Fronten stagniert hat oder in einigen Fällen sogar in die Barbarei zurückgefallen ist“, sieht Ruud Koopmans im islamischen Fundamentalismus. Anhand empirischer Studien setzt er sich mit der Diskriminierung von (religiösen) Minderheiten und von Frauen innerhalb der islamischen Welt, der Rolle des Westens sowie dem Zusammenhang von Islamismus und Terrorismus auseinander. Die Lösung der Konflikte liege in der Mitte der islamischen Gemeinschaft selbst. Liberale Muslime sollten sich massenhaft gegen Gewalt im Namen ihres Glaubens erheben.
Azadeh Zamirirad: Irans Atomdiskurs. Eine subsystemische Analyse außenpolitischer Präferenzen in der iranischen Nukleardiplomatie (2003-2015)
Azadeh Zamirirad fragt nach den inneriranischen Einflussfaktoren in der Nuklearpolitik und rekonstruiert die Präferenzen subsystemischer Akteure. Die iranische Nukleardiplomatie habe im Untersuchungszeitraum mehrere Positionsänderungen vollzogen, lautet eine ihrer Beobachtungen. Multilateralisten und Unilateralisten seien sich zumeist einig, dass „Iran das Recht zur eigenen Anreicherung von Uran“ zustehe. Die Atompolitik sei das Ergebnis eines „formellen wie informellen intraelitären Aushandlungsprozesses, an dem Akteure innerhalb und außerhalb der Regierungsverantwortung beteiligt waren“.
Matthias Küntzel: Nazis und der Nahe Osten. Wie der islamische Antisemitismus entstand
Wie die Geschichte der arabischen Welt durch den Nationalsozialismus geprägt wurde, erzählt Matthias Küntzel. 1937 veröffentlichten die Nationalsozialisten die Broschüre „Islam und Judentum“ und verbreiteten seine Inhalte unter anderem mithilfe des Radiosenders Zeesen in der arabischen Welt. Aufgrund dieser Propaganda habe sich das Judenbild im Islam verändert, es sei eine neue Form von Judenhass entstanden. Dass sich dieses Vorgehen des NS-Regimes auf die Gegenwart auswirkt, konstatiert der Autor und zeigt auf, was unter dem Begriff des islamischen Antisemitismus zu verstehen ist.
Annette Froehlich (Hrsg.): Post 2030-Agenda and the Role of Space. The UN 2030 Goals and Their Further Evolution Beyond 2030 for Sustainable Development
Es geht um die Frage, inwieweit eine nachhaltige Entwicklung langfristig, auch über 2030 hinaus, gesichert werden kann. Die Autor*innen vermitteln Denkanstöße und beziehen dabei den Weltraum mit seinen unterschiedlichen Implikationen in ihre Gedanken ein. Da er zur globalen Umwelt gehöre und schützenswert sei, ähnlich wie Wasser und Luft, wird beispielsweise erwogen, eine internationale „technical diplomacy“ für den Weltraum zu schaffen. Auch die Weltraumforschung könne zur Entwicklung von neuen Technologien führen, die der gesamten Erde dienten.
Dirk Jörke: Die Größe der Demokratie – Über die räumliche Dimension von Herrschaft und Partizipation
Dirk Jörke befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen territorialer Größe und Demokratiequalität. Er geht davon aus, dass demokratische Verhältnisse von einer überschaubaren Größe eines Gemeinwesens abhängen und Demokratie an den Nationalstaat gebunden ist. Supranationale Gebilde wie die Europäische Union ließen sich nicht demokratisieren; die Auslagerung von Herrschaftsbefugnissen aus den Mitgliedsländern habe zu einem erheblichen Demokratieabbau geführt. Unter Rückgriff auf ideengeschichtliche Positionen begründet Jörke die Rückverlagerung wichtiger Entscheidungskompetenzen auf die nationalstaatliche Ebene.
Kersten Lahl / Johannes Varwick: Sicherheitspolitik verstehen. Handlungsfelder, Kontroversen und Lösungsansätze
In der modernen global vernetzten Welt ist alles im Wandel, was auch auf die Sicherheitspolitik zutrifft. Deren Akteure sehen sich mit einem zunehmend komplexer werdenden Umfeld und vielschichtigen neuen Konfliktpotenzialen konfrontiert. Vor diesem Hintergrund diskutieren Kersten Lahl und Johannes Varwick die Schwächen und Stärken der Sicherheitspolitik, erläutern aktuelle Risiken der Unsicherheit, zeigen Zusammenhänge von globaler Ungleichheit, Migration sowie Sicherheit auf und erörtern künftige Handlungsstrategien für Deutschland und Europa.
Siegfried Karl / Hans-Georg Burger (Hrsg.): Herausforderung Integration: Wie das Zusammenleben mit Geflüchteten und MigrantInnen gelingt
Aktuelle Fragen der Integration von Migrant*innen in die bundesdeutsche Gesellschaft stehen im Fokus dieses Sammelbandes – wie etwa die nach dem Gelingen der Integration, der Einstellung der Bevölkerung zu Flüchtlingen sowie den Ursachen von Ängsten und Unsicherheiten. Integration bezeichnen Siegfried Karl und Hans-Georg Burger als eine „gesellschaftliche Dauer- und Zukunftsaufgabe“, die nicht allein dem Staat obliege. Sie könne nur gelingen, wenn sie sich in Verbindung mit dem Fremden vollziehe. Dabei sei es erforderlich, die zunehmende Diversität der Gesellschaft anzuerkennen.
Stephen Smith: NACH EUROPA! Das junge Afrika auf dem Weg zum alten Kontinent
Stephen Smith hat ein Buch über die mutmaßlichen Migrationsbewegungen von Afrika nach Europa vorlegt, das aufgrund der angenommenen hohen Zahlen über die Bevölkerungsentwicklung umstritten ist – seine Prognosen und damit das Bedrohungsszenario sind bereits vielfach kritisiert worden. Als zweiten Faktor, der Afrika momentan prägt, thematisiert der Autor die zunehmende Religiosität, insbesondere in ihrer fundamentalistischen Ausprägung. Was seinen Ausführungen dabei völlig fehlt, ist eine positive Idee davon, wie sich Afrika entwickeln könnte. Abschließend entwickelt Smith verschiedene Prognosen über den europäischen Umgang mit der Migration.
Samuel Salzborn: Globaler Antisemitismus. Eine Spurensuche in den Abgründen der Moderne
Samuel Salzborn entwickelt in seiner Analyse die These einer antisemitischen Revolution, deren dritte Welle islamisch geprägt sei und die ihren Auftakt mit den 9/11-Terroranschlägen erlebt habe. Ziel dieser Revolution sei eine Welt, in der sämtliche Errungenschaften von Aufklärung, Moderne und Demokratie zerstört werden. Diese These ist angebunden an den Revolutionsbegriff von Koselleck, die drei Phasen der Inter- und Transnationalisierung von Antisemitismus – des rechten, linken und islamischen – werden in Anlehnung an die Demokratisierungswellen nach Huntington herausgearbeitet.
Ahmad Mansour: Klartext zur Integration. Gegen falsche Toleranz und Panikmache
Der Psychologe und Religionskritiker Ahmad Mansour sieht nicht nur die deutsche Gesellschaft für das Gelingen einer Integration von zugewanderten Menschen in der Pflicht, sondern vor allem auch jene selbst – sie müssten bereit sein, manches, was in ihrem Herkunftsland galt, infrage zu stellen und die Werte ihrer neuen Heimat anerkennen. Mansour warnt ausdrücklich vor falsch verstandener Toleranz und benennt diese als Integrationshemmnis. Ein praktisches Beispiel sei die Schulpflicht, die unbedingt durchzusetzen sei. Staat und Gesellschaft sollten eine „Kultur der Inklusion“ fördern.
Fethi Benslama: Der Übermuslim. Was junge Menschen zur Radikalisierung treibt
Der Psychoanalytiker Fethi Benslama hat viele Jahre mit radikalisierten Jugendlichen in Pariser Vororten gearbeitet und befasst sich vor dem Hintergrund seiner praktischen Erfahrungen in seinem Buch mit den individualpsychologischen Faktoren der Radikalisierung von jungen Muslimen. Diese erweist sich demnach als ein Symptom einer Adoleszenzkrise, Gefühle von geringem Selbstwert und der Entwurzelung können die Entwicklung zum Übermuslim begünstigen. Deutlich wird in der Analyse auch, dass diese Radikalisierung die Freiheit der Frauen und die offene Gesellschaft grundlegend bedroht.
David Ranan: Muslimischer Antisemitismus. Eine Gefahr für den gesellschaftlichen Frieden in Deutschland?
David Ranan möchte beweisen, dass der muslimische Antisemitismus eigentlich nicht existiert und der israelisch-palästinensische Konflikt als ein ungelöster territorialer Konflikt gesehen werden müsse. Bei diesem Territorialstreit habe sich Israel militärisch durchgesetzt und daher seien die militanten Reaktionen der Araber und Palästinenser nicht per se antisemitisch. Der Autor stützt seine streitbare und für den Rezensenten nicht überzeugende Argumentation auf 70 Interviews mit muslimischen Intellektuellen.
Julia Ebner: Wut. Was Islamisten und Rechtsextreme mit uns machen
Zwar stehen sich radikale Islamisten und Rechtsextremisten diametral gegenüber, doch in ihren Zielen und Strategien seien sie sich nicht nur ähnlich, sondern würden voneinander profitieren und sich gegenseitig bestärken, so die These, hin zu einer Spirale der Gewalt. Anhand von mehreren Beispielen beschreibt und erklärt Julia Ebner diese Mechanismen und die Gemeinsamkeiten der extremistischen Bewegungen. Sie spricht von einer globalen Identitätskrise, die durch die Globalisierung, Technologie und Migration eine neue Dynamik bekomme und als Triebkraft für Radikalisierungen wirke.
Paolo Foradori / Giacomello Giampiero / Alessandro Pascolini (Hrsg.): Arms Control and Disarmament. 50 Years of Experience in Nuclear Education
In dieser Zusammenstellung grundlegender Texte zur Problematik von Rüstungskontrolle und Abrüstung spiegeln sich deren Geschichte ebenso wie grundsätzliche Überlegungen über die Motive und Handlungsmöglichkeiten der nationalstaatlichen Akteure. Ziel ist es, gerade auch vor dem Hintergrund des Ablebens der Generation, die die Atombomben-Abwürfe von Hiroshima und Nagasaki miterlebt hat, den Weg zur weltweiten Abrüstung und Nicht-Proliferation aufzuzeigen, ohne dabei naive Positionen einzunehmen. Nach Ansicht des Rezensenten Wahied Wahdat-Hagh liegt damit ein neues Standardwerk vor.
Stephan Grigat (Hrsg.): Iran – Israel – Deutschland. Antisemitismus, Außenhandel und Atomprogramm
Die Verbindungen zwischen Iran, Israel und Deutschland lassen sich insbesondere an den Themen Antisemitismus und Atomprogramm made in Iran aufzeigen. Sie bilden die beiden Schwerpunkte des Sammelbandes. Mit Analysen beispielsweise zur außenpolitischen Aggressivität des iranischen Regimes und seinen nuklearen Bestrebungen, zum Anstieg antisemitischer Ressentiments und zu der Frage, ob der politische Islam als faschistisch zu bezeichnen ist, bieten die Autorinnen und Autoren eine wenig optimistische Charakterisierung der Islamischen Republik Iran.
Farhad Rezaei: Iran’s Nuclear Program. A Study in Proliferation and Rollback
Sollte der Atomvertrag halten, sei das iranische Regime zum ersten Mal in seiner Geschichte effektiv zurückgedrängt worden. Diesen Schluss zieht Farhad Rezaei aus seiner politikwissenschaftlichen Analyse, in der er die Entwicklung des iranischen Atomprogramms aufzeigt und die Versuche schildert, dieses zurückzudrängen. Hervorgehoben wird, dass sich die internationale Gemeinschaft wie bei den früheren Sanktionen nicht für harte Zwangsmaßnahmen – wie zum Beispiel Schiffsblockaden – entschieden habe. Das Ziel sei mithilfe der Diplomatie und durch Wirtschaftssanktionen erreicht worden.
Alexander Pyka: Wirtschaftssanktionen der Vereinten Nationen und der Europäischen Union: Eine Analyse anhand des Sanktionsregimes gegen den Iran
Alexander Pyka lotet die völker- und europarechtlichen sowie die politischen Dimensionen der Sanktionen der VN und der EU gegen den Iran aus und entwickelt einen Prüfungsmaßstab für deren rechtliche Zulässigkeit. Deutlich wird, dass diese Sanktionen nicht der Durchsetzung von Recht dienten, sondern eine Verhaltensänderung des iranischen Regimes zum Ziel hatten. Die besondere Problematik bestand in diesem Fall darin, dass die technischen Mittel, die für ein ziviles Atomprogramm eingesetzt werden, mit geringem Aufwand auch zur Herstellung von Atomwaffen benutzt werden können.
Armin Nassehi: Die letzte Stunde der Wahrheit. Kritik der komplexitätsvergessenen Vernunft
Die Welt wird immer komplexer, bei immer sichtbareren Grenzen der Links-Rechts-Erklärungsmuster. Armin Nassehi nähert sich der unübersichtlichen Moderne über eine Wahrnehmung von Welten in Welten, deren unterschiedliche Logiken im Widerstreit miteinander stehen und der Vermittlung bedürfen. Nur so könne sich eine Pluralität der Lebensformen etablieren. Es geht also nicht darum, die eine Wahrheit über die Gesellschaft herauszufinden – diese gebe es nicht. Ein positives Beispiel für den Versuch, zwischen den Perspektiven zu vermitteln, sei die Arbeit des Ethikrats des Bundestags.