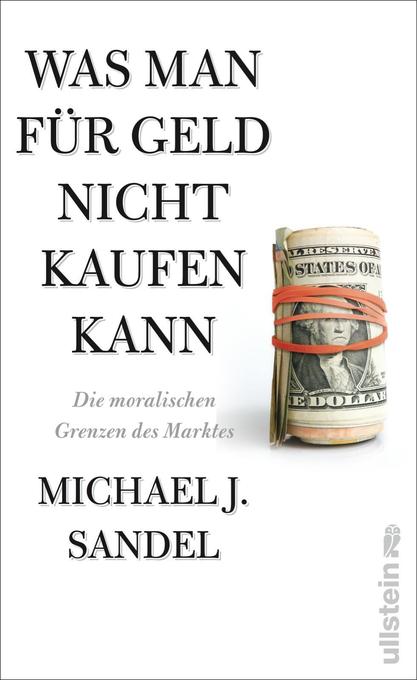
Was man für Geld nicht kaufen kann. Die moralischen Grenzen des Marktes. Aus dem Amerikanischen von Helmut Reuter
„Das Übergreifen von Märkten und marktorientiertem Denken auf Aspekte des Lebens, die bislang von Normen außerhalb des Marktes gesteuert wurden, ist eine der bedeutsamsten Entwicklungen unserer Zeit.“ (14) Ausgehend von dieser Gegenwartsdiagnose einer sich immer weiter ausbreitenden ökonomischen Hegemonie – in noch so unterschiedlichen Politikfeldern sowie in den jeweiligen Begründungen – formuliert Sandel seine zentrale Frage: Bis zu welchem Grad wollen wir noch die kollektiv verbindliche Entscheidungsfindung an die Märkte delegieren? Was folgt, ist Licht und Schatten zugleich. Wahrhaft erhellend und gleichsam bedrückend ist die schiere Flut an Beispielen, die Sandel – im Wesentlichen unter Rückgriff auf die US-amerikanische Gesellschaft – präsentiert und die allesamt anzeigen, wie sehr ökonomische Imperative schon heute unser Leben bestimmen. Das kann in ganz individuellem Rahmen über Anreizsysteme zur Sterilisation bei Angehörigen der Unterschicht oder über die Vergütung der Lesebereitschaft von Grundschülern geschehen oder auch in kollektiven Zusammenhängen, etwa dann, wenn im Sportstadion das ehedem gemeinschaftliche Erleben und Erleiden des Sports einer kompletten Segregation der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen gewichen ist – vom Stehplatz bis hin zu VIP-Loge. Schatten ist indes überall dort zu finden, wo es um die interpretative Aufbereitung der Gegenwartsdiagnose geht. Wenn Sandel nur auf den Phänomen- beziehungsweise Objektbereich von Ökonomisierung abhebt, dann verkennt er, dass die neoliberale Vermarktgesellschaftlichung, wie sie unter anderem von Michel Foucault und Wendy Brown beschrieben worden ist, ein ganz wesentlich diskursiv hervorgebrachtes Ensemble von hegemonialen, marktaffinen Begründungen darstellt. Mit anderen Worten: Nicht die „Tote-Bauern-Versicherung“ (164, über die schon Michael Moore in „Capitalism: A Love Story“ berichtete) ist das Problem, sondern die Argumente, die eine solche menschenverachtende Praxis im öffentlichen Diskurs überhaupt erst salonfähig gemacht haben. Hierzu jedoch schweigt sich Sandel in diesem Buch, das vor dem Hintergrund eines gegenwartsdiagnostisch interessierten, republikanischen Demokratieverständnisses insgesamt eine Pflichtlektüre ist, aus. Bezeichnend dafür ist, dass er mit einer – wohl rhetorisch gemeinten – Frage endet: Wollen wir eine Welt, in der alles käuflich ist? Mit Sicherheit nicht, kann man nach all den Beispielen nur entgegnen; wie sich der Weg in eine allgegenwärtige Ökonomisierung neoliberaler Provenienz durch gegenhegemoniale Strategien indes vermeiden, gar umkehren ließe, dazu fehlt die zündende Idee. Leider, denn erinnern wir uns: „Demokratie erfordert keine vollkommene Gleichheit, aber sie erfordert, dass Bürger an einer gemeinsamen Lebenswelt teilhaben.“ (250)