‚Make America Great Again‘? Die strategische Handlungs(un)fähigkeit der USA vom Ende des Kalten Kriegs bis zu Präsident Donald Trump

Den USA gelang es lange, im Dienste ihrer nationalen Interessen die eigene Vormachtstellung zu sichern und die liberale internationale Ordnung zu gestalten. Nach dem Kalten Krieg änderte sich das Bild, wie Gerlinde Groitl in ihrer Analyse zeigt, und der gesellschaftliche Rückhalt sank. Donald Trump treibt es jetzt auf die Spitze: Seine Außenpolitik ist die Fortsetzung des Wahlkampfs mit anderen Mitteln.
„Am Rande eines solchen Gipfels…“ Über Zentrum und Peripherie des G20-Treffens in Hamburg

Das Gipfeltreffen wurde von den Staats- und Regierungschefs dazu genutzt, Gespräche auch außerhalb des eigentlichen Programms zu führen. Sind diese als ein Bestandteil des Gipfels zu verstehen? Stefan Kroll äußert sich skeptisch.
„Die Selbstheilungskräfte dieses Systems sind ungeheuerlich“. Über die Konsequenzen aus den Midterm-Wahlen und die Zeit nach Trump

Wer hat die Midterm Elections tatsächlich gewonnen? Beide, Trump und die Demokraten, meint Markus Siewert im Gespräch mit Anke Sauter. Zu einem Stillstand des Gesetzgebungsverfahrens werde es durch die neuen Mehrheitsverhältnisse im Repräsentantenhaus aber nicht erst jetzt kommen: Schon die ersten zwei Amtsjahre des Präsidenten seien davon geprägt gewesen, weil Trump nicht einmal in seiner eigenen Partei um Mehrheiten geworben, sondern meist Entscheidungen administrativ umgesetzt habe. Welche Nachwirkungen diese Präsidentschaft haben werde, auch mit Blick auf Europa, bleibe offen.
Alan I. Abramowitz: The Great Alignment. Race, Party Transformation, and the Rise of Donald Trump
The Great Alignment. Race, Party Transformation, and the Rise of Donald Trump
Yale, Yale University Press 2018
Der US-amerikanische Politikwissenschaftler Alan Abramowitz erklärt die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten als Teil einer größeren politischen, kulturellen und sozialen Entwicklung in den Vereinigten Staaten. Anhand von Langzeitstudien wird sowohl das Erstarken der Republikaner als auch die Polarisierung der politischen Eliten erläutert, wobei sich der Autor vor allem auf die Erhebungen der American National Election Studies (ANES) bezieht. Zwar überzeugt diese empirisch angebundene Analyse grundsätzlich, andere mögliche Interpretationen geraten dabei allerdings etwas aus dem Blickfeld.
Amerika schaut in einen Spiegel. Der Sturm auf das Kapitol, seine Ursachen und Wir

Der Aufstieg Donald Trumps und der Sturm auf das Kapitol 2021 sind nur als Endpunkt einer politischen Entwicklung zu verstehen, die 1968 begann und die zurückliegenden 30 Jahre medial und kulturell dominierte, so die These Bruno Heidlbergers. Sie seien Symptome einer antiliberalen Konterrevolution von rechts, die sich gegen die offene Gesellschaft richte, ein Reflex auf Globalisierung und Modernisierung sowie Ausdruck eines globalen Kampfes zwischen emanzipativem Liberalismus und nationalem Autoritarismus. Der Sturm markiere eine Zäsur – für Amerika und die Glaubwürdigkeit der liberalen Demokratie in der Welt.
An der Schwelle zum autoritären Staat. David Frum analysiert die Determinanten der Präsidentschaft

David Frum extrapoliert in einer ausführlichen Analyse für die Zeitschrift The Atlantic die bisher von Donald Trump geäußerten politischen Einschätzungen, seine Einteilung der Menschen in Gewinner und Verlierer sowie sein persönliches Gewinnstreben und dessen Übertragung auf das Land („Amerika first“) bis in das Jahr 2021: „How to Build an Autocracy“.
Anonymus: Aus dem Regierungsalltag Donald Trumps. Ein hochrangiger Trump-Mitarbeiter packt aus
Warnung aus dem Weißen Haus. Ein hochrangiger Trump-Mitarbeiter packt aus (Übersetzt von Angela Koonen, Dietmar Schmidt, Rainer Schumacher)
Köln, Quadriga Verlag 2019
In diesem Sachbuch eines anonymen Mitarbeiters aus der Administration Donald Trumps wird der Regierungsalltag des 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika anschaulich beschrieben. In den einzelnen Kapiteln werden anekdotenhaft, vergleichbar dem Erzählstil einer Zeitungskolumne, Episoden aus dem Alltag Trumps dargestellt. Dabei bleibt unklar, ob der Autor die beschriebenen Szenen selbst erlebt hat oder ihm diese berichtet wurden. Der Autor misst das Verhalten Trumps anhand der Grundsätze von Weisheit, Gerechtigkeit, Besonnenheit, Tapferkeit und Mäßigung.
Bob Woodward: Furcht. Trump im Weißen Haus
Furcht. Trump im Weißen Haus
Reinbek, Rowohlt Verlag 2018
Auf der Basis ausführlicher Interviews mit Trumps engsten Mitarbeitern im Weißen Haus, Ministern und Anwälten zeichnet Bob Woodward das Bild einer chaotischen Präsidentschaft. Während Trump selbst nichts liest und explizit an seinen vor dreißig Jahren gefundenen Meinungen festhält, wird in seiner Administration entweder versucht, eine rechte Agenda durchzusetzen, oder das Schlimmste zu verhindern – notfalls unter heimlicher Entfernung von Dokumenten vom Schreibtisch des Präsidenten. In der Konsequenz sind die USA in der Außen- und Sicherheitspolitik zu einem unberechenbaren Akteur geworden.
Christoph Heusgen: Führung und Verantwortung. Angela Merkels Außenpolitik und Deutschlands künftige Rolle in der Welt
München, Siedler Verlag 2023
Jakob Kullik hat das jüngst erschienene Buch von Christoph Heusgen für uns gelesen. Letzterer blickt darin auf die Außenpolitik Angela Merkels und zugleich auf die künftige Rolle Deutschlands innerhalb der internationalen Beziehungen. Er skizziere damit verbundene Herausforderungen und betone stets die Notwendigkeit der Bewährung des Völkerrechts. All dies eruiere der Diplomat sowie ehemalige außen- und sicherheitspolitischer Berater der Altkanzlerin in zehn Kapiteln über die für Deutschland bedeutendsten Staaten und Regionen – ein eher „zahmes Buch“, bilanziert unser Rezensent.
Christopher Daase / Stefan Kroll (Hrsg.): Angriff auf die liberale Weltordnung. Die amerikanische Außen- und Sicherheitspolitik unter Donald Trump
Angriff auf die liberale Weltordnung. Die amerikanische Außen- und Sicherheitspolitik unter Donald Trump
Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften 2019
Während bis dato China, Russland und Indien als Gefahr für die liberale Weltordnung galten, stelle sich mit dem Auftauchen Donald Trumps die Frage, ob diese nicht von dem Land bedroht werde, das lange Zeit als Träger des Fundaments liberaler Werte galt. Denn der US-Präsident unterminiere mit seiner nationalistischen Politik die internationale liberale Weltordnung. Zudem untergrabe der Trump’sche Klientelismus die Problemlösungskraft internationaler Institutionen und gieße Öl ins Feuer, wo jahrzehntelange Verhandlungen fragile Gleichgewichte geschaffen hätten.
Das Streben nach Glück und die heroisierte Präsidentschaft. Das spezifisch „US-Amerikanische“ am Trumpismus

Jill Lapore und Wolfgang Fach geben Ausblick auf eine 250-jährige Geschichte ohne nennenswerte Zäsuren und damit Antworten darauf, welche Grundsätze das typisch „Amerikanische“ am Trumpismus ausmachen. Lepore sieht zudem im Anspruch der Liberalen, der Bösartigkeit Trumps und seiner Indifferenz gegenüber Regeln und Normen vor allem feste Grundsätze entgegenzusetzen, die Formatierung eines spezifischen „Neuen Amerikanismus“. Für Fach dokumentiert der Trumpismus vor allem das dekonstruierbar (Alb-)Traumhafte einer derart selbstbezogenen politischen Aufstiegs- und Regierungspraxis.
David Cay Johnston: Die Akte Trump
Die Akte Trump
Salzburg, Ecowin 2016
Die Biografie und vor allem das Geschäftsgebaren Donald Trumps haben bereits vor dessen Wahlsieg dem Pulitzer-Preisträger David Cay Johnston als Grundlage gedient, um dessen Persönlichkeit zu enthüllen. Nach der Maxime „Handeln ist Charakter“ (Francis Scott Fitzgerald) kommt er so zu dem Schluss, dass Trump für das Amt des US-Präsidenten gänzlich ungeeignet ist.
David Runciman: So endet die Demokratie. Faktoren ihrer Bedrohung
So endet die Demokratie
Aus dem Englischen von Ulrike Bischoff
Frankfurt/M., Campus 2020
David Runciman attestiert der westlichen Demokratie eine Midlife Crisis und fragt, „ob es sinnvoll wäre, die Demokratie durch etwas Besseres zu ersetzen“. Der britische Politologe stellt die Möglichkeiten dar, an denen die Demokratie zugrunde gehen könnte – nämlich Putsch, Katastrophe oder technologische Übernahme. Mark Zuckerberg sei für die Demokratie die größere Bedrohung als Donald Trump, weil Trump immerhin abgewählt werden könne: „Wahrscheinlich sieht das Schicksal der Demokratie so aus, dass die Trumps kommen und gehen und die Zuckerbergs weitermachen werden“.
Deborah Lipstadt: Der neue Antisemitismus
Der neue Antisemitismus
Übersetzt von Stephan Pauli.
München, Piper Verlag 2018
„Damit Juden als Volk überleben und gedeihen können, bedarf es weder eines absoluten Pessimismus noch eines naiven Optimismus, sondern Realismus“, schreibt Deborah Lipstadt, obwohl der gegenwärtig offen zutage tretende Antisemitismus nicht zu übersehen ist. Um diesen in seinen alltäglichen Erscheinungen spiegeln zu können, hat die Historikerin ihr Buch als fiktionalen E-Mail-Austausch zwischen ihr und zwei Gesprächspartner*innen angelegt. Thematisiert wird dabei auch, aufbauend auf einer gründlichen Recherche, der Antisemitismus führender Politiker wie Donald Trump oder Jeremy Corbyn.
Den Trumpismus verstehen: Die Außenpolitik des neuen amerikanischen Präsidenten

Jack Thompson fragt nach den außenpolitischen Prioritäten der Trump-Administration. Er gelangt zu dem Ergebnis, dass der neue US-Präsident keine strategische Leitvision hat, abgesehen von der vagen Überzeugung, dass die liberale Weltordnung den Vereinigten Staaten nicht nützt.
Der Fall Kavanaugh oder: Backlash in the USA. Neubesetzung des Supreme Court beendet den „progress without politics“

Der Trumpismus hat sich nach der Besetzung zweier Stellen im Supreme Court mit relativ jungen konservativen Richtern erfolgreich festgesetzt. Diese Entwicklung werden in Zukunft insbesondere die sozialen Bewegungen zu spüren bekommen, schreibt Tamara Ehs in ihrer Analyse: Es waren vor allem engagierte Gruppen und NGOs im Bereich der Frauen- und Menschenrechte oder auch des Umweltschutzes, die in den vergangenen Jahrzehnten mittels strategischer Prozessführung eine politische Liberalisierung erreichten – häufig ohne eine durch Wahlen mehrheitsfähige gesellschaftliche Verankerung. In Zukunft aber muss ihre Mobilisierung im parlamentarischen Raum erfolgreich sein.
Der geteilte American Dream. Die polarisierte US-Gesellschaft im Präsidentschaftswahlkampf 2020

Die Vereinigten Staaten sind 2020 in Aufruhr. Covid-19-Pandemie, Wirtschaftskrise, Straßenkämpfe und Proteste der Bewegung BlackLivesMatter gegen Polizeigewalt bilden das Grundrauschen eines Präsidentschaftswahlkampfes, in dem über nicht weniger als die Grundwerte der Nation entschieden werden soll. In diesem Digirama sind Kommentare und Kurzanalysen zusammengestellt, die die wesentlichen Eckpunkte und Entstehungslinien einer zutiefst gespaltenen und verunsicherten US-Gesellschaft beleuchten.
Der Iran nach dem Atom-Deal. Eine bleibende strategische Bedrohung
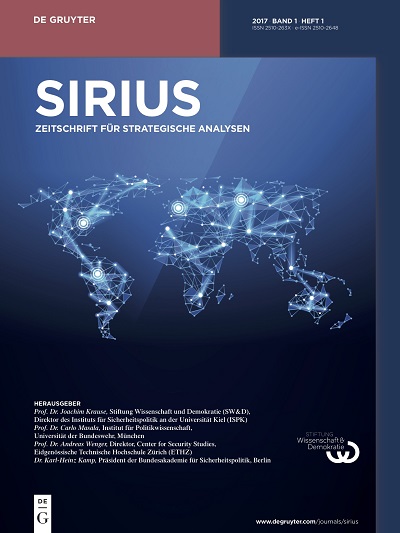
Im Blickpunkt dieses Beitrags stehen die Chancen auf einen kooperationsorientierten Wandel der iranischen Außen- und Sicherheitspolitik im Zuge des Nukleardeals. Wie die nähere Analyse zeigt, enthält das Abkommen zwar weitgehende Beschränkungen der iranischen Nuklearaktivitäten, kann aber mitnichten eine strategische Neuausrichtung des Irans herbeiführen. Die Ideologie des iranischen Regimes, die Agenda und der Einfluss des Teheraner Sicherheitsapparates sowie die gesamte strategische Orientierung des Landes lassen eine unverminderte Aggressivität gegenüber den Vereinigten Staaten, Israel und einer wachsenden Zahl arabischer Staaten erkennen.
Destruktiv statt disruptiv. Umwelt – Handel – Zölle – Steuern: Wem nützt die „America First“-Politik?

Eine Zusammenschau verschiedener Analysen weckt begründete Zweifel an den Erfolgsaussichten der Wirtschaftspolitik der Trump-Administration. Um sein Wahlkampfversprechen zu erfüllen, die Jobs in den USA zu sichern oder gar diejenigen, die ins Ausland verlagert wurden, zurückzuholen, verfolgt der Präsident eine konfrontative Handelspolitik unter Erlass von Strafzöllen und dem Rückzug aus multilateralen Absprachen. Mehrere Experten bescheinigen ihm, gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge nicht zu verstehen und so die globale Führungsrolle der USA zu gefährden.
- 1
- 2