Brian Michael Jenkins: The origins of America’s jihadists
Santa Monica, California, RAND Corporation 2017
In dieser Studie für die RAND Corporation versucht Brian Michael Jenkins die Ursachen des islamistischen Terrorismus in den USA zu ergründen. In den Mittelpunkt stellt er dabei diejenigen Jihadisten, die dort Anschläge verübt oder geplant haben. Zur Erklärung zieht er deren Lebensläufe heran und untersucht diese auf biografische Besonderheiten. Das übergreifende Ziel seiner Analyse ist, die Einwanderungs- und Einreisebestimmungen sowie das Handeln US-amerikanischer Sicherheitsbehörden mit Blick auf deren Fähigkeit, islamistische Anschläge zu verhindern, kritisch zu hinterfragen.
Extremismus von links. Ein- und Zuordnungen eines politischen Phänomens
... der gemeinsame Nenner der Extremismen, sei es Links-, Rechts- oder islamistischer Terrorismus, hervorgehoben: die Gegnerschaft zur Demokratie. Eine weitere Gemeinsamkeit besteht in der Ablehnung eines ......Stefan Hansen / Joachim Krause (Hrsg.): Jahrbuch Terrorismus 2015/2016. Im Fokus: Islamischer Staat und rechte Radikalisierung in Osteuropa
... Apokalypse.“ (75) Es finden sich weitere Beiträge zum Komplex islamistischer Terrorismus, so etwa zum IS in Libyen (Marie-Theres Beumler), zur Lage im Jemen und der dort recht erfolgreichen Struktur ......Terrorziel Deutschland
... Autor ist mit der Materie – islamistischer Terrorismus – bestens vertraut. Dies gilt auch für sein neues Buch zum „Heiligen Krieg“ in Deutschland. Die Kapitel sind wenig trennscharf voneinander abgegrenzt. ......Ein demokratischer Weg aus dem Terrorismus im Westen
Sophia Rost Ein demokratischer Weg aus dem Terrorismus im Westen. Islamistischer Terrorismus, Neofundamentalismus, politische Öffentlichkeiten und die globale Zivilgesellschaft ......islamistischer Terrorismus
islamistischer Terrorismus...„Warum tun Menschen so etwas?“ Ansätze und Eckpunkte der Radikalisierungsforschung

„Die Popularität des Konzepts ‚Radikalisierung‘ steht in keinem direkten Verhältnis zu seiner tatsächlichen Erklärungskraft bezüglich der Grundursachen von Terrorismus“ – ob diese so eindeutig und vernichtend formulierte Aussage des eminenten Terrorismusforschers Alex P. Schmid zutreffend ist, soll auch mit dieser Übersicht über Ansätze und Entwicklungen de Radikalisierungsforschung zu bewerten versucht werden.
Behnam T. Said: Geschichte Al-Qaidas. Bin Laden, der 11. September und die tausend Fronten des Terrors heute
Geschichte Al-Qaidas. Bin Laden, der 11. September und die tausend Fronten des Terrors heute
München, C. H. Beck 2018
Manchmal ist ein Spin Off erfolgreicher als das Original – genau das ist al-Qaida passiert. Diese „Basis“ des Dschihadismus, die verantwortlich für eine neue Qualität des transnationalen Terrorismus zeichnet, wurde von ihrer irakischen Filiale, dem sogenannten Islamischen Staat, sowohl medial als auch zunächst durch militärische Erfolge an den Rand gedrängt. Behnam Said erläutert allerdings, dass dieser Eindruck täuscht: al-Qaida hat sich zu einem effektiv gesteuerten Netzwerk mit Ablegern in verschiedenen Regionen weiterentwickelt. In seinem Buch zeigt er diesen gesamten Kontext auf.
Brian Michael Jenkins: The origins of America’s jihadists
Santa Monica, California, RAND Corporation 2017
In dieser Studie für die RAND Corporation versucht Brian Michael Jenkins die Ursachen des islamistischen Terrorismus in den USA zu ergründen. In den Mittelpunkt stellt er dabei diejenigen Jihadisten, die dort Anschläge verübt oder geplant haben. Zur Erklärung zieht er deren Lebensläufe heran und untersucht diese auf biografische Besonderheiten. Das übergreifende Ziel seiner Analyse ist, die Einwanderungs- und Einreisebestimmungen sowie das Handeln US-amerikanischer Sicherheitsbehörden mit Blick auf deren Fähigkeit, islamistische Anschläge zu verhindern, kritisch zu hinterfragen.
Britt Ziolkowski: Die Aktivistinnen der Hamās. Zur Rolle der Frauen in einer islamistischen Bewegung
Die Aktivistinnen der Hamās.
Zur Rolle der Frauen in einer islamistischen Bewegung
Berlin, Klaus Schwarz Verlag 2017 (Studien zum Modernen Orient 29)
Welche Rolle spielen Frauen in extremistischen Organisationen wie der Hamās, was motiviert sie zu ihrem Engagement? Welchen Beitrag leisten sie zum Erfolg der Organisation? Britt Ziolkowski hat mit diesen Fragen eine weitgehende Forschungslücke ausgemacht und, um diese zu schließen, rund dreißig Aktivistinnen der Hamās ausführlich befragt. Es zeigt sich, dass die Interviewten in ihrem Aktivismus die Chance sehen, ihre Gesellschaft positiv zu beeinflussen. Die feministische Perspektive auf ihr Handeln erweist sich allerdings nicht als erkenntnisfördernd, zumal sie selbst ihre Unterordnung nicht infrage stellen.
Freund gegen Feind, Republik gegen Terrorismus. Der republikanische Kandidat François Fillon sieht das Land bedroht

Der Präsidentschaftskandidat François Fillon präsentiert sich wert- und rechtskonservativ, in seinen Aussagen bewegt er dabei sich auf dem schmalen Grat zwischen Rechtskonservatismus und Rechtspopulismus, wie in seinem Buch „Vaincre le totalitarisme islamique“ nachzulesen ist. So will er im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus, den er als den gefährlichsten Feind der Republik ansieht, nach einem Wahlsieg die Regelungen zum Schengen-Raum neu verhandeln.
Gilles Kepel: Chaos. Die Krisen in Nordafrika und im Nahen Osten verstehen
Chaos. Die Krisen in Nordafrika und im Nahen Osten verstehen
München, Antje Kunstmann 2019
Das Buch des französischen Soziologen und Arabisten Gilles Kepel könne nach Einschätzung des Rezensenten Michael Rohschürmann durchaus als sein Opus magnum angesehen werden, denn darin fasst der Autor die Erfahrungen seiner inzwischen 40-jährigen Beschäftigung mit den muslimischen Ländern des Mittelmeerraumes zusammen. So sei Kepels Anspruch alles andere als bescheiden, da er die gesamte politisch-religiöse, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung des Nahen Ostens, des Irans und Nordafrikas seit 1973 beschreiben will – alles unter dem passenden Titel „Chaos“.
Jahrbuch „Extremismus & Demokratie" 2019 und 2020. Bewährtes Forum der vergleichenden Extremismusforschung
Rezensent Thomas Mirbach widmet sich zwei Ausgaben des Jahrbuches „Extremismus & Demokratie". Für die des Jahres 2019 werde angesichts des Inkrafttretens der Weimarer Reichsverfassung ein vergleichender Blick auf die erste und zweite deutsche Demokratie geworfen und gefragt, inwieweit Strukturschwächen der Verfassung zum Zusammenbruch der Republik geführt haben. Bei den Analysen des Bandes für das Jahr 2020 dominierten Partialstudien. Zwar stellten die Jahrbücher ein bewährtes Forum für die vergleichende Extremismusforschung dar, doch sollten sie, so Mirbach, stärker für neuere sozialwissenschaftliche Konzepte geöffnet werden. (ste)
Jan Ilhan Kizilhan / Alexandra Cavelius: Die Psychologie des IS. Die Logik der Massenmörder
Die Psychologie des IS. Die Logik der Massenmörder
Berlin u. a., Europa Verlag 2016
Die Motivationen, die hinter terroristischen Gewalttaten stehen, stoßen seit jeher vor allem auf Unverständnis – abgesehen vielleicht von einem relativ kleinen Kreis von Sympathisanten. Was den sogenannten Islamischen Staat (IS) angeht, potenziert sich dieses Unverständnis allerdings zu fassungslosem Grauen. Der Psychologe Jan Ilhan Kizilhan, anerkannter Experte für Traumapsychologie, betreute in den vergangenen Jahren mehr als tausend jesidische Frauen und Kinder, nachdem sie vom IS versklavt und auf das Schwerste misshandelt worden waren. Er und die Autorin Alexandra Cavelius veröffentlichen nun einige der Erfahrungsberichte und analysieren anhand dieser die Täterpsychologie.
Jannis Jost, Joachim Krause (Hrsg.): Jahrbuch Terrorismus 2019-2021
Jahrbuch Terrorismus 2019-2021
Stuttgart, Verlag Barbara Budrich 2022
Der Fokus dieses inhaltlich sehr dichten und stringent abgefassten Bandes liege auf rechtsextremistischen Gewalttaten, so Wahied Wahdat-Hagh. Ergänzt werde dies durch Beiträge zu den aktuellen Entwicklungen von islamistischem und linkem Terrorismus. Während globale Radikalisierungsphänomene vor allem mit statistischen Methoden fassbar werden, zeigten Analysen für Europa, dass dort meist Einzeltäter*innen aus unterschiedlichsten Beweggründen und ohne feste Organisationsbindung aktiv würden, so ein Fazit des Buchs.
Kein Patentrezept. Ansätze der De-Radikalisierungsforschung
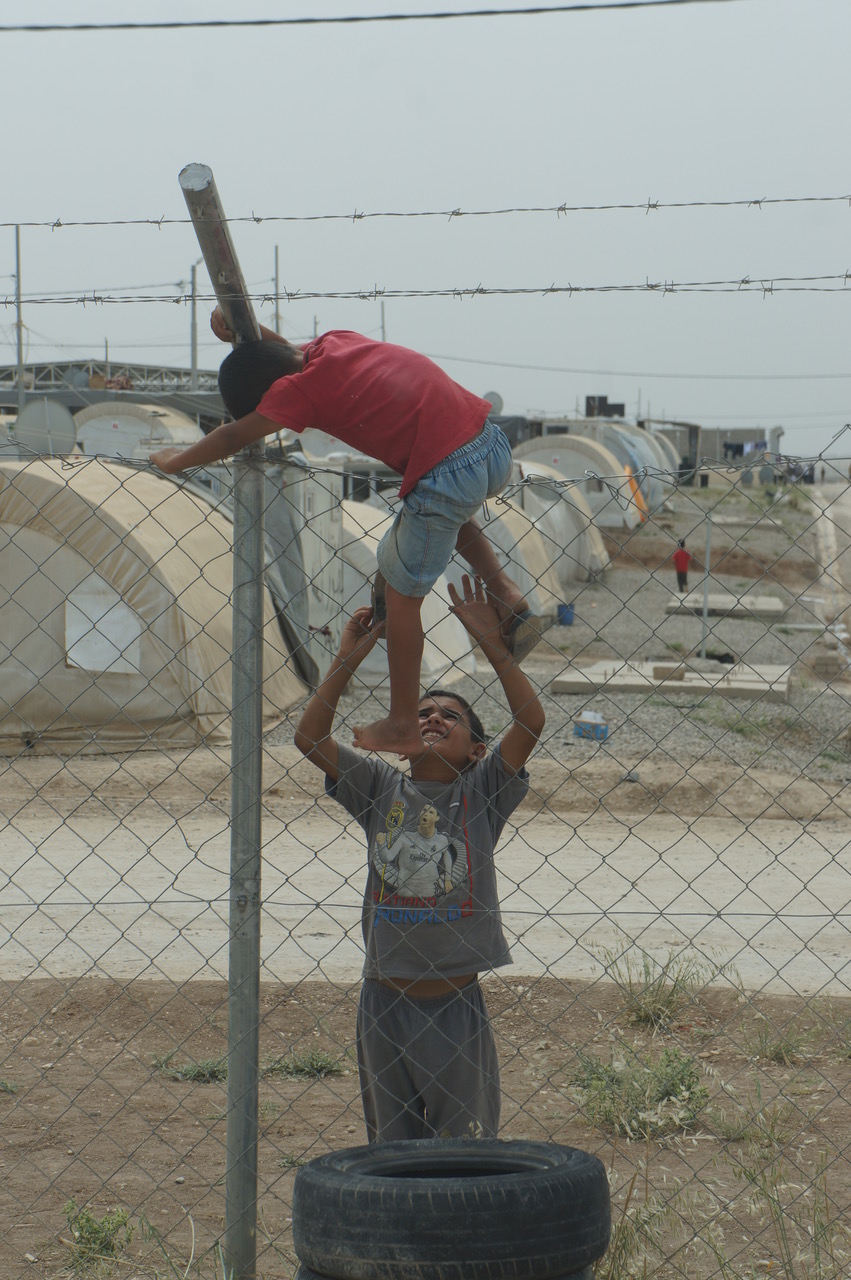
Während über die Radikalisierung und Rekrutierung von islamistischen Extremisten insbesondere seit einem Jahrzehnt intensiv geforscht wird, hat es bis vor Kurzem relativ wenig Literatur zum Thema De-Radikalisierung gegeben. Zwei Studien, die sich als Einstiegs- und Überblickslektüre eignen, werden näher vorgestellt: Während Hamed El-Said verschiedene De-Radikalisierungskonzepte anhand von Länderbeispielen darstellt, fragen Angel Rabasa et al. nach generalisierbaren Kriterien für den Erfolg von De-Radikalisierungsmaßnahmen.
Michail Logvinov: Das Radikalisierungsparadigma. Eine analytische Sackgasse der Terrorismusbekämpfung?
Das Radikalisierungsparadigma. Eine analytische Sackgasse der Terrorismusbekämpfung?
Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften 2018 (essentials)
Die Erforschung des Terrorismus befindet sich nach Ansicht von Michail Logvinov seit 9/11 auf einem Irrweg. Er kritisiert vor allem, dass der Ideologie der Täter eine unangemessen hohe Bedeutung zugeschrieben wird. Damit widerspricht er einem naiv-linearen Verständnis des Radikalisierungsprozesses und stellt stattdessen Erinnerungsfiguren heraus, auf die sich die verschiedenen islamistischen Strömungen gemeinsam beziehen. Neben diesen kulturellen Aspekten hebt Logvinov in seinem ausführlichen Essay vor allem die Bedeutung sozioökonomischer Motive für eine Radikalisierung hervor.
Paulo Casaca / Siegfried O. Wolf (Hrsg.): Terrorism Revisited. Islamism, Political Violence and State-Sponsorship
Terrorism Revisited. Islamism, Political Violence and State-Sponsorship
Cham, Springer International Publishing 2017
Paulo Casaca und Siegfried O. Wolf stellen mit ihrem Autorenteam einen neuen Ansatz vor, um sich zeitgenössischen terroristischen Erscheinungsformen zu nähern. Dazu werden sowohl historische Entwicklungen als auch Fallstudien untersucht. Staatlich unterstützter Terrorismus spielt ebenso eine Rolle wie Formen der generellen politischen Gewalt. Thematisch bewegen sich die Artikel von der iranischen Revolution über das Anwachsen des sunnitischen Terrorismus und dessen historischer Verbindung zu Pakistan über nationale Dschihadbewegungen bis hin zu den sogenannten tamilischen Befreiungstigern.
Peter R. Neumann: Der Terror ist unter uns. Dschihadismus und Radikalisierung in Europa
Der Terror ist unter uns. Dschihadismus und Radikalisierung in Europa
Berlin, Ullstein 2016
Der islamistische Terrorismus ist „unter uns“, wie es der Titel dieses Buches von Peter R. Neumann etwas reißerisch verdeutlicht. Das ist er allerdings schon seit Jahren, möchte man hinzufügen. Die Zahl ...
- 1
- 2