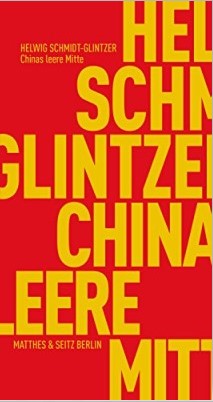Helwig Schmidt-Glintzer: Chinas leere Mitte. Die Identität Chinas und die globale Moderne
18.07.2018Vielleicht können wir gar nicht anders, als von unserem europäischen Standort aus auf China zu blicken und es zu beurteilen. Der Sinologe Helwig Schmidt-Glintzer, Direktor des „China Centrum Tübingen“, versucht in diesem Essay trotzdem, unser Fernglas zumindest schärfer zu stellen. Dies geschieht vor dem Hintergrund der unübersehbaren Entwicklung der Volksrepublik zu einem der, wenn nicht dem entscheidenden Player im frühen 21. Jahrhundert und in der Absicht, die Moderne als das zu begreifen, was sie ist: global. Seine These lautet, dass „China für die globale Moderne möglicherweise besser gerüstet ist als die meisten anderen Länder“ (9).
Der Grund dafür sei, dass Chinas Geschichte, wie Schmidt-Glintzer schreibt, bis in die Gegenwart „von diesem Wechselspiel lokaler Experimentierwerkstatt und regionaler Reform einerseits und Modernisierung andererseits geprägt“ (15) sei. Diese Methode, nach Versuch und Irrtum vorzugehen, dürfte einen wesentlichen Anteil am ökonomischen Aufstieg des Landes haben, so wurde die kapitalistische Art des Wirtschaftens bei Beibehaltung eines kommunistischen Systems zunächst in Sonderwirtschaftszonen getestet. Die anfänglichen Erwartungen des Westens, dass aus diesem wirtschaftlichen Kurswechsel als historische Gesetzmäßigkeit (was wiederum eine geradezu marxistische Idee ist) eine Demokratisierung folgen wird, sind bisher allerdings enttäuscht worden.
China scheint also seinen ganz eigenen Weg zu beschreiten und hat damit in der Welt eine zuvor für unmöglich gehaltene Position eingenommen, durchaus nicht ohne Zweifel und begleitet von der Suche nach seiner Identität. Dabei weiß das „Reich der Mitte“ durchaus um sich selbst und seine Geschichte, wie der Autor hervorhebt, und seine historischen Erfahrungen, die sicher die Experimentierbereitschaft der Kommunistischen Partei beflügelt haben, könnten auch die Ressource für die Ausgestaltung der neuen, globalen Moderne sein.
Am Aufgangspunkt der Argumentation steht die Feststellung, dass China nie ein von einem homogenen Staatsvolk getragener Nationalstaat gewesen ist. Seine frühe und bis in die Gegenwart wirkende kulturelle Identität lässt sich dennoch klar umreißen, wie Schmidt-Glintzer ausführt, sie ist geprägt durch Schrift und (Standard-)Sprache, einen Kalender und die rituelle Ermittlung glückverheißender Tage, „die patrilokale und patrilineare Familien- und Sippenstruktur“ (19), den Himmelsbegriff als Mandat der Macht sowie eine Raumordnungskonzeption. Diese tief verankerte Identität stand dabei lange einer inneren Vielfalt nicht entgegen, so die Schilderung, die sich unter anderem durch die Denkschule nach Konfuzius ebenso auszeichnete wie durch verschiedene Ethnien, Religionen und Sprachen, außerdem eine „Vielzahl von Ordnungskonzepten und Deutungssystemen“ (17).
Zur grundlegenden historischen Erfahrung gehört dabei auch das Zusammenspiel und Auseinanderdriften von Zentralgewalt und Regionen, wie immer halten sich auch in der Gegenwart die „Fliehkräfte und Zentralisierungsbemühungen […] nur gelegentlich die Waage“ (18). Mit Blick auf die Geschichte liegt zudem die Vermutung nahe, dass oben genanntes Wechselspiel von Reform und Modernisierung nicht immer unter dem Dach des kommunistischen Einheitsstaates bleiben muss – die „Idee des Staatszerfalls“ (27) ist virulent geblieben. Schmidt-Glintzer nennt dazu das berühmte Zitat aus dem Roman Die Drei Reiche von Luo Guanzhong: „Die Geschichte lehrt, dass die Macht über die Welt, wenn sie geteilt war, geeint werden muss, und wenn sie lange geeint war, geteilt werden muss.“ (27)
Zu einem Machtwechsel muss es allerdings nicht durch eine Revolution kommen, das „‚Verblassen der Götter‘“, mit dem die Mitte des Reiches einst leer und zum Ort der individuellen und gesellschaftlichen Aushandlung wurde, wird als historisches Vorbild aufgezeigt. In der Folge war der Kaiser als „symbolisch-kosmologische[r] Erdmittelpunkt“ inszeniert worden, der im Idealfall durch Nichthandeln „zur Aufrechterhaltung der Ordnung“ (31) beitragen sollte. Bei abgewandelter Wiederholung dieses Prozesses könnte sich das Volk dann ungestört selbst regieren. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sieht Schmidt-Glintzer es allerdings als offene Frage an, ob es zu einer einklagbaren Verfassung kommen wird, in der eine Pluralität von Werten und Interessen, die die Mitte ausmachen, wie der Bundesverfassungsrichter Andreas Voßkuhle zitiert wird, geschützt würde. Die Sinnkrise des Landes, in dem das kommunistische Regime erst versuchte, die historisch-kulturelle Identität vergessen zu machen und dann ihrer Politik das gegenteilige Wirtschaftssystem zufügte, bleibt demnach also vorerst bestehen – und die leere Mitte, in ihrer gebauten Form als Platz des Himmlischen Friedens, durch das Mao-Mausoleum besetzt.
Die leere Mitte ist also vor allem eine Idee davon, was Chinas Stärke sein könnte – das Zulassen von verschiedenen Ordnungskonzepten und individuellen Interessen. Der tatsächliche Zustand sieht nach Beschreibung von Schmidt-Glintzer allerdings anders aus: „Innenpolitisch ist China heute von einer großen Dynamik gekennzeichnet. Die Regierung fürchtet Unruhen, und daher ist sie am sozialen Ausgleich interessiert.“ Um die Kontrolle zu behalten, werde ein „fragmentierter Autoritarismus“ (58) praktiziert, aber niemand wisse, wie lang der innere Frieden halten werde.
Das letzte Drittel des Buches ist der „Geschlossenheit einer offenen Welt“ gewidmet, wobei die Rekonstruktion historischer Staatsverständnisse wiederum in die Gegenwart verweist – so bei der Feststellung, dass Herrschaft und Heil nicht durch einen Einbruch von außen aufzubrechen sind, sondern sich durch Verfall und schlechte Herrschaft trennen. Der Exkurs mag insgesamt geschichtlich aufschlussreich sein, wer sich für die aktuelle chinesische Politik interessiert, hätte vielleicht eher gerne eine kurze historische Einordnung der weiteren Zuspitzung der Macht auf Xi Jinping gelesen. Bemerkenswert ist auf jeden Fall die Schlusspassage: Europa könne aus dem „durchaus prekären, zugleich aber bisher weitgehend gelungenen und sich fortsetzenden Modernisierungsprozess“ lernen, lautet die These, denn dieser sei nur durch „weitsichtige Planung und staatliche Lenkung“ (99) so erfolgreich. Eine explizit kritische Einschränkung unter Hinweis etwa auf die Rechtlosigkeit der Binnenmigranten oder die massive Umweltverschmutzung hätte in diesem Moment den Fokus aber doch angemessen vergrößert.