Kristin Helberg: Der Syrien-Krieg. Lösung eines Weltkonflikts
25.06.2019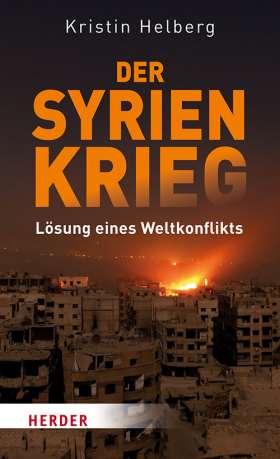
Kristin Helberg unternimmt den ambitionierten Versuch, auf 240 Seiten eine der komplexesten Krisen der Gegenwart zu beschreiben, zu analysieren und auch noch Lösungswege vorzuschlagen. Es ist beinahe schon erstaunlich, dass sie diesem Anspruch auch weitgehend gerecht wird.
Zunächst beschreibt sie die historischen Hintergründe, den Aufstieg der Baath-Partei sowie der Familie Assad und folgt dann einer nachvollziehbaren nicht „soziologischen, sondern geografischen Herangehensweise“ (64), wenn sie die Interessen von Syrerinnen und Syrern nicht entlang externer Zuschreibungen wie Ethnizität oder Konfession, sondern – nachvollziehbar logisch – aufgrund ihrer Erfahrungen im Verlauf des Bürgerkrieges darstellt. Dabei lassen sich die folgenden Gruppen erkennen:
- Menschen in den dauerhaft vom Regime kontrollierten Gebieten, vor allem an der Küste. Diese haben häufig das Narrativ des Regimes übernommen und betrachten sowohl die Einwohner der Oppositionsgebiete wie auch die islamistischen Milizen als Terroristen.
- Menschen in Gebieten, die zunächst von der Opposition, dann vom IS und anschließend wieder vom Regime kontrolliert wurden, müssen sich weitgehend mit dem Regime arrangieren und viele betrachten die Regierung von Assad inzwischen als das kleinere von zwei Übeln.
- Die Menschen in den kurdisch kontrollierten Gebieten (häufig selbst Kurden) haben auch keine tatsächlichen Freiheiten – die kurdische PYD (Partiya Yekîtiya Demokrat) ist eine Einheitspartei, die zu kritisieren nur bis zu bestimmten roten Linien erlaubt ist. Durch die Möglichkeit, ihre Kultur und Sprache aber offen zu leben – was unter Assad nicht möglich war – fühlt es sich für diese Menschen allerdings mehr nach Freiheit an als zuvor. Gleichzeitig ist diese aber durch die türkische Militäroperation und die syrische Armee bedroht.
Wie bereits bei der Ausbreitung seiner Macht nutzt das Regime konsequent die Ängste und Befürchtungen der unterschiedlichen Ethnien und Religionsgemeinschaften des Landes aus, um diese gegeneinander auszuspielen und die Opposition zu spalten – divide et impera auf Syrisch. Helberg selbst sieht keinen Konflikt zwischen Alawiten und Christen einerseits und Sunniten andererseits. Vielmehr würden sich die Konfliktlinien quer durch die Ethnien entlang der Grenzen der Loyalität zum Regime ziehen.
Der Sieg Assads beruhe, Helberg zufolge, neben der internationalen Unterstützung des Regimes aus Russland und dem Iran, sowie der militärischen Untätigkeit des Westens, vor allem auf innersyrischen Konfliktdynamiken: „Erstens einen zivilen Widerstand, der auf Illusionen statt auf Strukturen baute und dessen Stärke zugleich seine Schwäche ist. Zweitens einen bewaffneten Aufstand, der aufgrund der Unterstützung, die er bekam – zu viel zum Verlieren, zu wenig zum Siegen, – zur Manipulationsmasse degenerierte. Und drittens eine vom Ausland abhängige politische Opposition, die zwischen hehren Zielen, Pragmatismus und ideologischer Verbohrtheit laviert und immer unbedeutender wird.“ (114)
Sie stellt fest, dass „sich die Opposition als so divers wie die syrische Gesellschaft selbst“ (141) erwies. Vor allem mit der bewaffneten Opposition habe sie sich häufig den Radikalen und Dschihadisten annähern müssen, da die Unterstützung aus dem Westen zur Fortführung des Kampfes gegen das Regime nicht ausgereicht hätte. Die Tatsache jedoch, dass beispielsweise „die Nusra Front vielerorts mit dem bewaffneten Widerstand verwoben“ (150) war, führte dazu, dass sich der Westen noch weiter von den Rebellen abwandte.
Bis heute ist sich die Opposition uneinig über den zukünftigen Charakter Syriens: Soll es ein „arabisch-islamischer Staat“ (153) sein? Damit können sich die Vertreter der Minderheiten nicht anfreunden. Diese Uneinigkeit wird den Vertretern der Opposition immer wieder vom Westen vorgeworfen und vom Regime und seinen Verbündeten als Argument für ihre Sache genutzt. Helberg fragt aber zu Recht, was man realistisch nach einem so langen Konflikt erwarten könne. „[U]nd warum sollte die syrische Gesellschaft in diesem Punkt weiter sein als die deutsche, die mit einer Kopftuch tragenden Ministerin und einem muslimischen Kanzler erhebliche Probleme hätte? Obwohl die deutschen seit Jahrzehnten unter einer Verfassung leben, die keinen Unterschied zwischen den Religionen und Ethnien macht.“ (153)
Vor allem im letzten Teil wird ein guter Überblick über die verschiedenen Akteure der Region sowie deren jeweiligen Interessen – auch über Syrien hinaus – vermittelt und auch nach dem Sieg Assads – eine düstere Zukunftsprognose abgegeben: „[S]olange in Syrien ein schwaches und abhängiges Regime herrscht, wird das Land ein Spielfeld bleiben, auf dem andere Mächte ihre Rechnungen begleichen.“
Auf internationaler Ebene sieht Helberg eine „Syrienisierung der Welt“ (209). So habe der Konflikt gezeigt, dass das Zeitalter zwischenstaatlicher Konflikte vorbei sei. Ausländische Mächte schickten ungerne eigene Truppen, operierten stattdessen über Proxies und Milizen. Nicht mehr nur Weltmächte, sondern auch zunehmend kleinere Regionalmächte entschieden über Krieg und Frieden in ganzen Weltgegenden. Zudem seien internationale Systeme geschwächt und das Prinzip der Bündnistreue zugunsten kurzfristiger Zweckbündnisse aufgegeben worden.
Als Vergleichsfolie empfiehlt sich dringend die Lektüre von Herfried Münklers „Der Dreißigjährige Krieg“. Dabei wird klar, dass Helbergs „Syrienisierung“ letzten Endes nur das erneute Hervorbrechen einer vorwestfälischen Ordnung in den internationalen Beziehungen darstellt. Dieser zwischenstaatliche Kampf aller gegen alle war durch den Westfälischen Frieden und die Herausbildung des modernen internationalen Rechts eingehegt worden. Dies funktionierte allerdings nur solange alle Akteure mitspielten. Beginnend mit dem US-amerikanischen regime change-Interventionismus wurde dieses System systematisch ausgehöhlt – bis zu einem Punkt, an dem sich die „Diplomatie in Syrien als Totalausfall“ (156) erweise.
Auch Helbergs guter und detaillierter Beschreibung der Lage kommt die Gretchenfrage des Syrienkonfliktes immer wieder in die Quere: Was können wir glauben. Sie gesteht selbst ein, die Gebiete, über die sie berichtet, nicht bereist zu haben und daher auf Gespräche und Berichte angewiesen zu sein. Das ist vorbildlicher Journalismus! Allerdings bedingt dies die Glaubhaftigkeit derjenigen Zeugen, die sie heranzieht. Dabei ist sie geneigt, vor allem den Aussagen der Regimegegner besondere Glaubwürdigkeit zuzugestehen, während positive Aussagen zum Regime in ihren Augen aus der Kombination von Gehirnwäsche und Angst resultierten. Es soll in keiner Weise behauptet werden, dass das Regime nicht Unterdrückung, Propaganda und Mord einsetzt, um seine Macht zu sichern. Was aber fehlt ist ein realistischer Blick auf die tatsächlichen Kapazitäten einer Opposition unter den Rahmenbedingungen der krebsartig gewucherten Kontrolle des Regimes in allen Gesellschaftsschichten, die sie selbst sehr zutreffend beschreibt. Waren es tatsächlich nur die Fassbomben Assads, die die Opposition schwächten und den Aufstieg der Dschihadisten begründeten? Lag dies nicht strukturell in der Schwäche einer unkoordinierten Opposition und einer diffusen Unzufriedenheit ohne eine klare Systemvorstellung nach einem etwaigen Erfolg des Aufstandes begründet? Hatte der Aufstand unter diesen Bedingungen von Anfang an nur zwei mögliche Enden: einen Sieg religiöser Radikaler (da diese immer besser vernetzt und organisiert sind), den Sieg des Regimes, oder ein dauerhaftes Chaos wie in Libyen?
