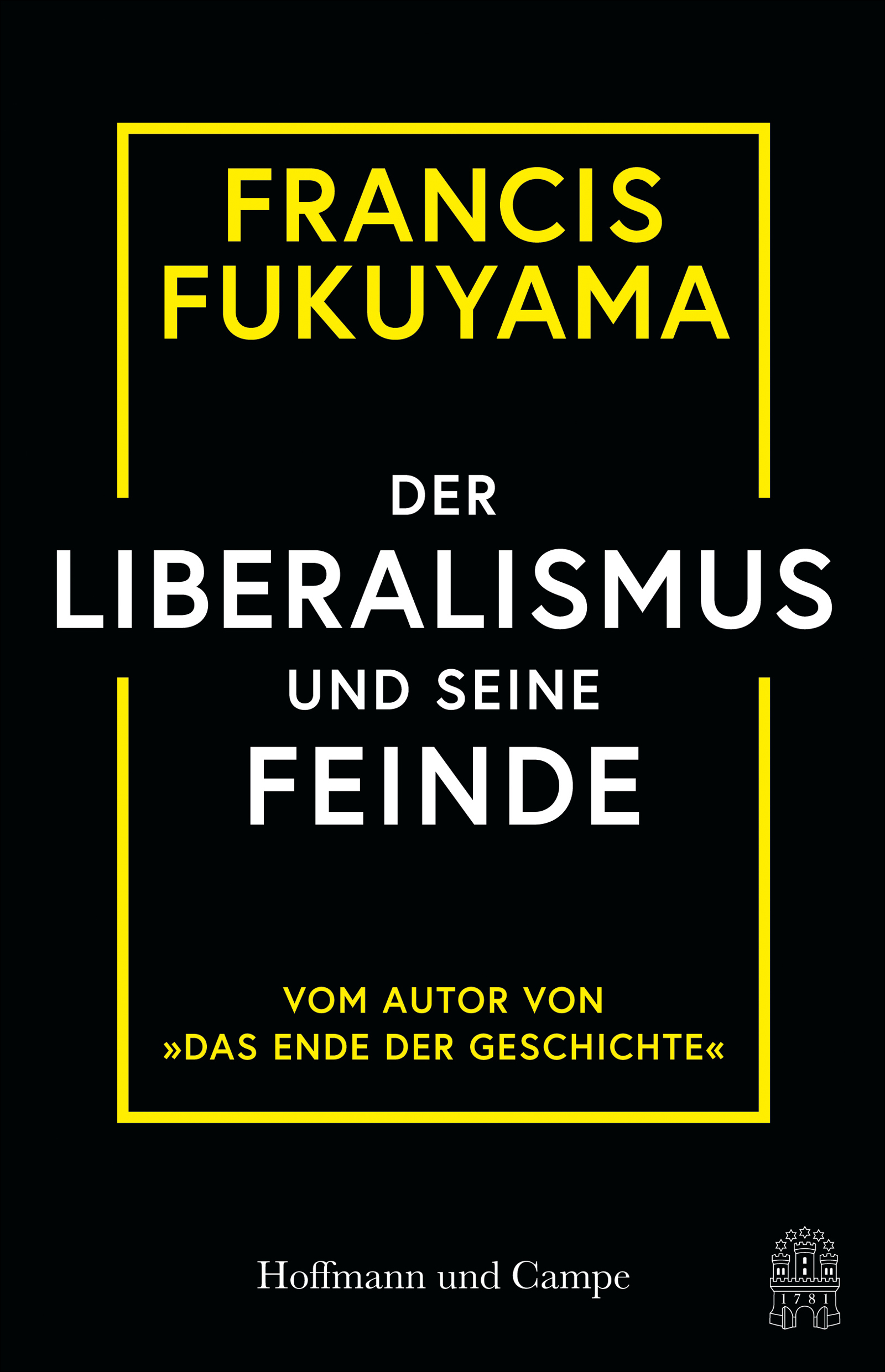Francis Fukuyama: Der Liberalismus und seine Feinde
22.02.2023Rainer Lisowski lobt das vorliegende Buch als „klar und schlüssig strukturiert“ und „im Stil gut lesbar geschrieben“, in dem Francis Fukuyama seine Thesen zum aktuellen Stand des politischen Liberalismus für ein breites Lesepublikum verdichtet. Eine echte Alternative zum Liberalismus sehe Fukuyama nicht, er arbeitet daher die Fehlentwicklungen des verbreiteten Verständnisses nach Rawls heraus. So benennt er im vorliegenden Essay aktuelle Bedrohungen durch Fehlentwicklungen, vor allem auf die USA bezogen, und diskutiert fünf Punkte, um zu einem klassischen Liberalismus zurückzukehren. (tt)
Eine Rezension von Rainer Lisowski
„Im liberalen Sinne heißt liberal nicht nur liberal“. Vor vielen Jahren scherzte Deutschlands Altmeister des feinen Humors, Loriot, über hohle Sprache in der Politik und zugleich darüber, wie entkernt und blutleer das politische Programm vieler Parteien seiner Ansicht nach war. Besonders die Liberalen traf oftmals eben dieser Vorwurf. Positiv könnte man argumentieren: Der Liberalismus hat sich seit seiner Entstehung im 17. Jahrhundert zu Tode gesiegt. Wenige politische Strömungen würden in westlichen Demokratien heute gern von sich behaupten, sie seien illiberal. Aber die Kehrseite der Medaille lautet eben: Wenn alle „irgendwie“ liberal sind – was sagt dieser Begriff dann noch aus?
Auftritt eines weiteren Altmeisters. Einem aus unserer Zunft, der Politikwissenschaft. Francis Fukuyama hat mit „Der Liberalismus und seine Feinde“ ein neues Buch vorgelegt. Deutlich weniger umfangreich als seine bekannte Monographie über politische Ordnungen, versucht Fukuyama nun neu zu vermessen, was den (klassischen) politischen Liberalismus heute ausmacht, warum er noch gebraucht wird und von wem er unter Druck gesetzt wird. Liberalismus ist dabei nicht parteipolitisch, sondern (politik-)philosophisch gemeint.
Der längere Essay von etwa 200 Seiten ist in zehn Kapitel unterteilt. In den ersten beiden Kapiteln umreißt Fukuyama zunächst, durch welche Gedanken und Ideen sich der klassische Liberalismus auszeichnet und wie aus diesem – so Fukuyama – der weniger gehaltvolle Neoliberalismus unserer Tage wurde. Da die Fokussierung auf das Individuum ein, vielleicht sogar das Wesensmerkmal des Liberalismus ist, befassen sich die Kapitel drei und vier mit dem selbstsüchtigen (negativ) und dem selbstbestimmten (positiv) Individuum. Die Kapitel fünf und sechs zeichnen nach, wie sich der Liberalismus allmählich gegen sich selbst wandte und warum insbesondere die Kritik an der Rationalität bei dieser Wende eine zentrale Rolle spielte. Verstärkt werden aus Sicht des Autors die Verfallserscheinungen des politischen Liberalismus durch soziale Medien und ein verändertes Verständnis von Privatsphäre und Redefreiheit, weshalb diese im Mittelpunkt des siebten Kapitels stehen. Pro forma fragt das achte Kapitel, ob es Alternativen zum Liberalismus gibt. Die Frage sei sogleich mit „Nein“ beantwortet denn aus Fukuyamas Sicht gibt es keine guten Alternativen. Etwas verlegen eingeschoben wirkt das neunte Kapitel, welches die nationale Identität thematisiert. Kapitel zehn schließlich versucht final Prinzipien einer liberalen Gesellschaft aufzustellen und sich erneut auf seine Kernwerte zu besinnen.
Mit Werten beginnt auch Fukuyamas Reflexion. Was zeichnet für ihn politischen Liberalismus aus? Er stellt die Bedürfnisse Einzelner in den Mittelpunkt und versucht das Individuum zu schützen – gegen kontrollierende Regierungen, übergriffige Religionsgemeinschaften oder auch die Enge des Dorfes. Er ist moralisch egalitär. Jeder Mensch zähle moralisch genauso viel wie der andere. Was eine wichtige politische Implikation beinhaltet: Ein liberaler Staat kenne kein moralisches Staatsziel, keinen anzustrebenden Gesellschaftsentwurf. Er sei ein ergebnisoffener Staat. Da Politik aber oft eine hitzige Angelegenheit ist – eben, weil um Ziele und Gesellschaftsvorstellungen gestritten wird – habe der Liberalismus staatliche Institutionen aufgebaut, die ein Stück weit der demokratischen Kontrolle entzogen seien und deren Aufgabe darin bestehe, die Betriebstemperatur von Politik abzusenken (22). Immer wieder, so Fukuyama, sei dieser Liberalismus von anderen Strömungen herausgefordert worden. Vor hundert Jahren etwa von Kommunismus und Faschismus. Und stets habe er sich langfristig als Sieger erwiesen.
Warum also die wachsende Skepsis gegenüber dem Liberalismus? Zunächst einmal wegen der seit den 1980er-Jahren wachsenden ökonomischen Ungleichheit, meint Fukuyama. Allerdings erinnert er an die Gründe für die damals von Ronald Reagan und Margaret Thatcher eingeführte Wende in der Wirtschaftspolitik: Hohe Inflation, hohe Arbeitslosigkeit und eine allgemeine Perspektivlosigkeit gegen Ende der sozialdemokratisch geprägten 1970er-Jahre. Von einem „trostlosen Jahrzehnt“ (39) spricht er mit Blick auf diese keynesianisch geprägte Dekade. Die liberale Wende löste erst einmal den kräftigen Boom der 1980er-Jahre aus. Nach und nach aber, habe man es übertrieben. Vor allem in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion habe der blinde Glaube an die alles heilende Kraft der Märkte zu wilden Auswüchsen geführt, deren Auswirkungen auch heute noch zu spüren seien. Doch auch im Westen habe sich eine teilweise irrationale Feindseligkeit gegenüber dem Staat breitgemacht, die empirisch nicht zu rechtfertigen sei. In einigen Bereichen könne der Markt allein nicht die nötigen Güter in Menge und Qualität sicherstellen, etwa in Fragen der Nahrungsmittelsicherheit oder der Gesundheitsvorsorge (46). Insgesamt plädiert Fukuyama für Augenmaß. Zu wenig Staat lasse zu viele Menschen angesichts unvorhergesehener Schicksalsschläge im Regen stehen und zu wenig Markt führe dazu, dass Menschen unkluge Risiken eingehen und zu wenig Verantwortung für ihr eigenes Leben übernehmen.
So gelangt er zu seiner Diskussion des Individuums: Teils selbstsüchtig, teils selbstverantwortlich. Eine Fokussierung auf das Individuum und seine Nutzenmaximierung sei keineswegs falsch, aber angesichts der stets auch prosozialen Züge des Menschen unvollständig (62), meint der Autor. Mit Miniaturen zum Menschenbild von Thomas Hobbes, John Locke, Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau und John Rawls versucht er die liberale Idee des selbstbestimmten Individuums trotz all ihrer inneren Widersprüchlichkeiten klarer zu umreißen. Rawls dominiere heute insbesondere in akademischen Kreisen (75), diagnostiziert Fukuyama. Seine Überhöhung der Wahlfreiheit und der Autonomie des Menschen aber trage vielleicht gerade dazu bei, dass sich die Rawls’schen Ideen allmählich totgelaufen haben und dass der Liberalismus (eben der Rawls’schen Prägung) unter Druck gerate. Selbst schreibt er es zwar nicht so explizit, aber man erkennt gut: Fukuyama erachtet den Liberalismus eines Rawls für zu technisch gedacht, für zu blutleer, für zu wenig wertebasiert. Rawls Überbetonung von Werteneutralität hat für ihn klar mit dazu beigetragen, dass der Liberalismus begonnen habe, sich selbst in Frage zu stellen (85).
Fukuyama zeichnet verschiedene Stränge der Kritik am Liberalismus nach: Durch die „Kritische Theorie“ eines durchaus intolerant denkenden Marcuse, durch Antikapitalisten, durch den Feminismus, der dem Liberalismus vorwerfe, per se patriarchal zu sein. Aus seiner Sicht gelingt es dem kritischen Lager aber keineswegs, die Grundideen des politischen Liberalismus zu widerlegen. Ihrerseits zeichne sich die Kritik in der Regel zahlreich durch eigene Widersprüchlichkeiten aus. Wenn beispielsweise ausschließlich der Kolonialismus erst den wirtschaftlichen Aufschwung der liberalen Gesellschaften ermöglicht habe, wie wäre dann zu erklären, dass ursprünglich nicht-liberale asiatische Gesellschaften ebenfalls reich wurden? Fukuyama bezweifelt beispielsweise, dass der Kolonialismus die ehemaligen Kolonien vollständig ausgeblutet und nur er den wirtschaftlichen Aufschwung der westlichen Gesellschaften ermöglicht hätte. Wie könne es dann sein, dass heute in Asien eben nur die liberalen Staaten reich geworden wären, nicht aber die übrigen? Singapur ist hier ein treffendes Beispiel: Ehemals britische Kolonie – heute reicher als die meisten europäischen Länder. Zudem stellt er eine ganz praktische Frage in den Raum: Wenn in den westlichen, liberalen Gesellschaften alles so furchtbar wäre, wie die Kritik es behaupte – wie könne man dann erklären, dass Millionen von Menschen ihr Leben aufs Spiel setzen, um als Geflüchtete oder über reguläre Migration in diese Länder zu gelangen?
Maß und Mitte sind Fukuyama wichtig. Überhaupt sei Mäßigung kein schlechtes politisches Prinzip (190). Diese aristotelische Grundidee durchzieht das ganze Buch. Allerdings hindert ihn sein Mäßigungsgebot nicht daran, sich Michel Foucault und Jacques Derrida vorzuknöpfen. Sicher hätten sie Recht gehabt mit manchen ihrer Ideen von der Dekonstruktion der Macht. Aber auch hier wurde aus seiner Sicht wieder übertrieben, etwa indem das gesamte naturwissenschaftliche Denken als „Macht“ dekonstruiert wurde – ein naiver Gedanke, der sich aktuell bei manchen Progressiven wiederfindet, so zum Beispiel bei Ashley Dawson. Doch nicht nur die politisch Progressiven seien zu stark vom Dekonstruktivismus durchdrungen und damit zum Beispiel für die sprachliche Übersensibilisierung unserer Tage verantwortlich (115). Auch Rechtslibertäre wie etwa Peter Thiel hätten sich das problematische Denken Foucaults und anderer längst zu eigen gemacht. Gesellschaft werde so nur noch als reine Machtfrage begriffen, als Nullsummenspiel (122) mit allen negativen Konsequenzen.
Aber können diese und andere Kritikerinnen und Kritiker den Liberalismus ersetzen und eine echte Alternative anbieten? Aus Fukuyamas Sicht keinesfalls. „Keine der Extrempositionen hat eine realistische Alternative zum klassischen Liberalismus anzubieten, doch beiden [radikaler rechter Libertarismus und linker Dekonstruktivsmus] ist es gelungen, liberale Ideale anzukratzen und jene Menschen zu diskreditieren, die für sie eintreten.“ (159). Umso wichtiger sei es, die liberalen Institutionen, die Regierungs- und Mehrheitsmacht einschränken, zu erhalten. Auch die größten gesellschaftlichen Mehrheiten seien nicht davor gefeit, schlechte Entscheidungen zu treffen (152). Und ja, die Macht der demokratischen Mehrheit zu beschränken sei oftmals frustrierend und manchmal vielleicht sogar schädlich. Regierungsmacht nicht zu beschränken, sei aber auf Dauer viel gefährlicher, weil wir uns niemals sicher sein könnten, wie gut oder übel künftige Herrschaft aussehen mag (107).
Wo droht dem Liberalismus (in den USA, auf die dieses Buch bezogen ist) Gefahr? Von rechts bei zu vielen Waffen in den Händen selbsternannter Bürgerwehren oder rechter Politik, die die Spielregeln verzerren will, indem Wahlen manipuliert werden könnten. Aber ebenso von links, weil der progressive Diversitätsgedanke konservative oder religiöse Menschen eben nicht miteinschließe und unliebsame Meinungen gerne tilgen würde. Dabei übersähen die Linken in ihrer moralischen Voreingenommenheit aber, dass die Hälfte der Menschen ihre Politik nicht gut finde.
Was sollten die Liberalen tun? Fukuyama nennt fünf Punkte, um zu einem klassischen Liberalismus zurückzukehren. Zum Ersten müsste der Liberalismus sein nahezu allergisches Verhalten gegen alles Staatliche aufgeben. Zum Zweiten müssten die Exzesse eines rein ökonomisch denkenden Neoliberalismus überwunden werden (zur Erinnerung: Das Buch ist ausschließlich auf die USA gemünzt). Zum Dritten sollte politischer Subsidiarität wieder mehr Gewicht eingeräumt werden, damit lokale Gemeinschaften sich ein Leben so gestalten könnten, wie sie es für richtig hielten. Zum Vierten müsse Redefreiheit wieder richtig verstanden und durchgesetzt werden, sowohl gegen den Staat als auch gegen große Konzerne und Medienkartelle. Am wichtigsten aber ist vielleicht sein fünfter Vorschlag: Die Privatsphäre – eine liberale Errungenschaft – wieder stärker wertzuschätzen und die Menschen so sein zu lassen, wie sie im Privaten gerne sein möchten. Das bedeutet in letzter Konsequenz auch zu ertragen, wenn das Ehepaar nebenan aus meiner Sicht rassistisch denkt oder aber wenn sie das Recht zur Abtreibung befürworten.
Alles in allem ist Fukuyama wieder einmal ein gutes Buch gelungen. Sehr übersichtlich, da klar und schlüssig strukturiert und im Stil gut lesbar geschrieben, richtet es sich nicht nur an eine rein akademische Leserschaft oder an ein Massenpublikum, sondern bespielt beide Arenen. Weder unterfordert es die einen, noch überfordert es die anderen. Kritisch kann man einwenden: Wer bereits sein letztes Buch zur Identitätspolitik gelesen hat, dem werden die allermeisten Gedanken sehr vertraut vorkommen. Dennoch sind sie eine passende Verdichtung seiner Thesen. Und sie sind vielleicht auch sehr nötig in einer Welt, in der viele politische Strömungen sich liberal gerieren, es beim genaueren Blick aber nicht sind. Denn liberal zu sein, bedeutet heute nicht immer, liberal zu sein, um in Anlehnung an Loriot zu schließen.