Caroline Fourest: Generation beleidigt. Von der Sprachpolizei zur Gedankenpolizei. Über den wachsenden Einfluss linker Identitärer.
25.05.2021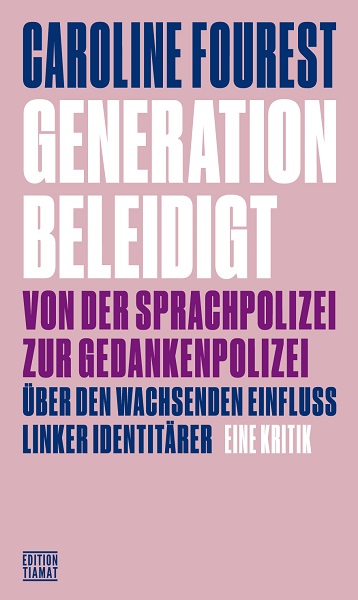
Aus dem Französischen von Alexander Carstiuc, Mark Feldon, Christoph Hesse
Über den wachsenden Einfluss linker Identitärer. Eine Kritik
Ob die politische Linke die Klassenfrage in Fokus stellen oder sich identitätspolitischer Forderungen annehmen sollte, bewegt die Gemüter – nicht nur hier, sondern auch in Frankreich. In ihrer Streitschrift „Die beleidigte Generation“ zeigt sich die ehemalige Charlie-Hebdo-Kolumnistin Caroline Fourest angriffslustig gegenüber der von ihr so titulierten „identitären Linken“. Sie kreidet ihr Sprachverbote und eine Überempfindlichkeit an, die drohe, in neuen Ausgrenzungen zu münden. Mit ihren schwungvoll darlegten Beispielen kann sie unseren Rezensenten Rainer Lisowski überzeugen.
Eine Rezension von Rainer Lisowski
Die „Identitären sind nicht die neuen Anti-Rassisten, sondern vielmehr die neuen Rassisten“ (92). Die Auseinandersetzung der ehemaligen Charlie-Hebdo-Kolumnistin Caroline Fourest mit linker identitärer Politik hat es in sich. In ihrer knapp 150-seitigen Streitschrift setzt sie sich mit den Fehlentwicklungen dieser Spielart multikultureller Politik auseinander und präsentiert dabei sehr eindrucksvolle Beispiele. Ihre Analyse schließt an eine Reihe anderer Publikationen an, die Ähnliches im Sinn haben und die zum Teil von linken oder liberalen Autorinnen und Autoren stammen. Exemplarisch erwähnt werden sollten Cinzia Sciutos tiefschürfende Analyse „Die Fallen des Multikulturalismus“ (2020) oder Mark Lillas „The Once and Future Liberal: After Identity Politics“ (2017).
Fourests Buch dient dem Zweck, ein Übergreifen links-identitärer Sichtweisen von angelsächsischen Ländern auf Europa zu verhindern. Die Autorin vertritt die Kernthese, dass es insbesondere in den USA keinen universalistischen Zugang zu ethnischen Problemen mehr gebe, sondern nur noch einen rassisch-identitären. Zwei gegensätzliche Konzepte von Antirassismus hätten sich entwickelt, zwei Konzepte, die sich einander ausschließend gegenüberstünden: auf der einen Seite ein universalistisch geprägter, republikanischer und säkularer Antirassismus, der die Gleichbehandlung aller Menschen unabhängig von ihrer Hautfarbe oder geschlechtlichen Orientierung zu erstreiten versuche und der antitotalitär ausgerichtet sei. Auf der anderen Seite stehe ein zum Fundamentalismus neigender, identitärer Antirassismus, der eben keine Gleichbehandlung, sondern eine besondere Behandlung wie auch immer gearteter Minderheiten propagiere (49 ff.). Letztere Spielart sei eben vor allem in angelsächsischen Ländern zu finden. Denn diese Gesellschaften versuchten nicht mehr, eine ethnische Zuordnung per se zu bekämpfen und diese aufzulösen. Im Namen gesellschaftlicher Vielfalt betonten und verschärften sie vielmehr die Vorstellung von Rassen und von Unterschieden. Dieser identitäre Antirassismus habe in den USA, Großbritannien und Kanada mittlerweile die Linke zerschlagen (51 f.). In Europa werde weitgehend noch der alte Universalismus vertreten. Aber Ideen wie Critical Whiteness und andere Irrwege identitärer Politik schwappten über den Atlantik. Die Autorin plädiert dafür, diese zu stoppen, bevor es zu spät sein könnte.
Das Buch ist in achtzehn Kapitel mit journalistisch-illustrativen Überschriften untergliedert. Sein logischer Aufbau lässt sich aus stilistischen Gründen nicht gleich erkennen. Fourest beginnt mit der Frage, wie so etwas wie eine „Meute 2.0“ entstehen könne: Geschützt durch die Anonymität des Internets und die eigene Gruppe der Gleichgesinnten, keilten „Zensoren“ ohne weiteres Nachdenken gegen Menschen aus, die ihrer Meinung nach rassistisch wären (11-15). Oft laute der Vorwurf: kulturelle Aneignung. Dieses Konzept und seine Tücken lassen sich mit der Autorin am Beispiel der erhobenen, schwarzen Faust erläutern. Sie ist ein wichtiges Symbol der Befreiungsbewegungen in Afrika, meist verbunden mit dem alten FRELIMO-Kampfruf „A luta continua!“.
Darf nun jemand, der an dieser Befreiungsbewegung nicht teilgenommen hat, das Symbol benutzen? Fourest würde antworten, dass es wesentlich von der Intention einer solchen Aneignung abhängt. Würde etwa ein Bekleidungsunternehmen die schwarze Faust nur deshalb auf ein T-Shirt drucken, um damit viel Geld zu verdienen, läge der Verdacht einer „missbräuchlichen Verwendung“ vermutlich zu Recht nahe. Geht es um kommerzielle Gewinne und um Ausbeutung zum Nachteil derjenigen, die ein kulturelles Artefakt geschaffen hatten, dann sei der Vorwurf der kulturellen Aneignung gerechtfertigt (zur Erinnerung: Die Autorin ist dezidiert „links“). Fourest kritisiert aber, dass der mittlerweile entgrenzte Begriff kultureller Aneignung exakt diesen Blick auf die Intention über Bord geworfen habe (16-21). Mittlerweile würde jedem der legitime Gebrauch „nicht eigener“ Symbole abgesprochen, auch und gerade Künstlern und Künstlerinnen. Dies ist aus Fourests Sicht besonders heikel. Denn die Produktion kultureller Güter geschehe zu einem wesentlichen Anteil immer durch Inspiration und Auseinandersetzung mit einer fremden Kultur. Künstler sollen, folgt man Fourest, Kulturen mischen.
Völlig zu Recht weist die Autorin im Übrigen darauf hin, dass Kulturen kein Eigentum einzelner Menschen oder Gruppen sind. Maßen diese sich an, für eine ganze Kultur zu sprechen, dann sei es in der Regel genau dies: eine Anmaßung (74 ff.). Überhaupt sei fraglich, ob eine Kultur etwas ausschließlich für sich reklamieren könne. Was wäre beispielsweise, wenn eine bestimmte Kultur eine medizinisch hochwirksame Pflanze, die nur in ihrer Region vorkommt, als Heiligtum ihrer Kultur betrachte und deren Nutzung für die ganze Welt ausschließen würde? Wäre es etwa gerecht, diese kulturelle Eigenart gegen das Leiden vieler Menschen auf der Welt aufzuwiegen? (95)
Der Kultur- und Wissenschaftsbetrieb werde durch solche und ähnliche Ideen von kultureller Reinheit zunehmend erschwert. Das Gespür für den richtigen Maßstabe scheine verloren gegangen. Nebensächlichkeiten wie Rastalocken würden, so Fourest, zu großen Themen aufgeblasen und Menschen im Namen des Antirassismus mundtot gemacht. Die Reaktion der in die Enge Gedrängten: formelhafte, oftmals kleinlaute Entschuldigungen (27-33). Fundamentalistische Reflexe schössen dabei weit über das Ziel hinaus und demontierten mittlerweile sogar antirassistisch gemeinte Kunst, wofür Fourest mehrere Beispiele bringt.
Noch handele es sich vor allem um angelsächsische Phänomene, aber die Autorin registriert verschiedene Versuche, diesen „Kulturterror“ zu importieren (37). Insbesondere Kanada bezeichnet sie dabei als Reallabor Nummer Eins für identitäre Politik. Das Land lasse alle „Exzesse der Ideologie des Multikulturalismus“ zu. Man erkenne dort nicht, dass dessen identitäre Spielart zu nichts führe und nichts wiedergutmache, sondern im Grunde mehr Schaden als Nutzen anrichte (67-73). Denn das Ziel identitärer Politik mag Gleichheit sein. Doch ihr Preis sei immens, insofern sie Stereotype befeuere und Rachegelüste befördere (61 f.).
Der Autorin ist darin zuzustimmen, dass das das Ganze mitunter seltsame Blüten treibt, von denen hier nur drei benannt werden:
Sie verweist zum Beispiel auf einen Vorfall in den USA, bei der sich eine vietnamesische Studentin empört und beleidigt zeigte, weil das vietnamesische Gericht Banh Mi nicht dem Original entsprechend zubereitet worden war. Mit fein-säuerlichen Humor verweist die Autorin darauf, dass dieses Gericht erst unter Einfluss der französischen Küche in der Kolonialzeit entstand, und fragt, ob man damit nun also den kulinarischen Beitrag des Kolonialismus respektieren müsse (103 f.).
Erwähnt sei noch ein zweites Beispiel der Autorin: Verlage gehen mittlerweile so weit, „sensivity readers“ zu beschäftigen, die Manuskripte nur daraufhin durchlesen, ob irgendeiner Minderheit womöglich vor den Kopf gestoßen werde. Die Autorin empfiehlt, nebenbei bemerkt, den Beleidigten eine andere Vorgehensweise: Man könne schlicht und ergreifend etwas anderes lesen (84; 87).
In eine ähnliche Kategorie fallen drittens die allmählich um sich greifenden Selbstbezichtigungen wie etwa die Forderung, sich seiner „privilegierten Weißheit“ bewusst zu werden. Eine von der Autorin beschriebene Episode am Evergreen College im Bundesstaat Washington erinnert Leserinnen und Leser an die düsteren Beschreibungen Frank Dikötters zu den Exzessen der chinesischen Kulturrevolution: Menschen wurden demütigend gezwungen, öffentlich Selbstkritik zu leisten und sich ihrer „Privilegien“ bewusst zu werden, um sie dann ganz eindeutig als Klassenfeinde abstempeln zu können. Der Rest ist bekannt. Daher bezeichnet Caroline Fourest die Befürworter solcher Ideen als das, was sie sind: Scharlatane – und zudem solche, die durch ihre extremen „Trainings“ oft gar nicht wenig Geld verdienen würden. Sie vermutet ein Geschäftsmodell hinter dieser Masche (120-127).
Um sich von solchen Wirrungen zu befreien, helfe es zum Beispiel auf eine originär politische Perspektive umzuschwenken. Ganz bewusst thematisiert die sich selbst als linke, lesbische Feministin bezeichnende Autorin dies am Beispiel der Bedeutung des Schleiers. Absurderweise verteidigten gerade selbsternannte Feministinnen den Schleier und zeigten so politisches Unvermögen – ein Unvermögen, das erzkonservativen Fundamentalisten in die Hände spiele. Weltweit zahlten Frauen in muslimischen Ländern einen hohen Preis für die Forderung nach dem Recht, den Schleier ablegen zu dürfen, wenn sie das wollten. Leidenschaftlich plädiert die Autorin dafür, Fundamentalisten – egal ob männlich oder weiblich – nicht durch kulturelle Relativität zu unterstützen (117 f.).
Leider seien die „Kultur-Taliban“ (109) heute auch deshalb so erfolgreich, weil eine hyperempfindliche Jugend lautes, forderndes Klagen als erfolgreiche Strategie erkannt habe und diese dementsprechend nutze. Zudem habe die Generation Y keine eigenen Erfahrungen mit Sklaverei, Kolonialismus, Deportationen oder den Auswüchsen des Totalitarismus (101; 128). Ihre Angehörigen wüssten also oftmals gar nicht, wovon sie wirklich redeten. Indem sie selbst oft in die USA reist und gezielt das Streitgespräch mit dieser Generation sucht (wovon sie lebhaft berichtet), versucht Fourest ihren Beitrag zu leisten, ein Umdenken zu erreichen.
Fourest schreibt in ihrem Buch nicht beleidigend, aber oft sehr konfrontativ. Dies passt auch zu einer Botschaft, die ihr wichtig ist: Leidenschaftliche Debatte und auch Streit gehören zu emanzipierten Gesellschaften dazu. Identitäre Politik mit ihrer Idee von „Mikroaggressionen“ geht für sie von einem falschen Glauben aus: Sie nimmt jede legitime Konfrontation sogleich als Aggression wahr (119).
Caroline Fourest ist mit „Generation beleidigt“ eine ganz wunderbare, teils deftige Streitschrift gelungen, die trotz der eigenen (zum Teil leicht antikapitalistischen) Schlagseiten Pflichtlektüre jedes Kurses zu Interkulturalität werden sollte. „Aber wir sind von solchen Exzessen doch weit entfernt“ mag der eine oder die andere einwenden. Sind wir das? Der jüngste Umgang der SPD-Spitze mit Wolfgang Thierse und Gesine Schwan in der Genderdebatte wirft auch bei uns dunkle Schatten voraus.
