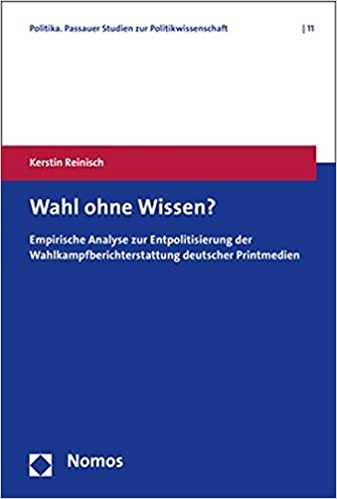Kerstin Reinisch: Wahl ohne Wissen? Empirische Analyse zur Entpolitisierung der Wahlkampfberichterstattung deutscher Printmedien
28.07.2017Medien spielen eine zentrale Rolle in der repräsentativen Demokratie. Besonders in Wahlkampfzeiten sollen Zeitungen, Radio- und Fernsehanstalten die Bürgerinnen und Bürger über politische Positionen und Wahlversprechen der Parteien informieren. Jedoch scheinen die Medien die ihnen demokratietheoretisch zugesprochene Rolle als Vermittler zwischen Politik und Wählerschaft kaum noch wahrzunehmen. Schlagworte wie „Amerikanisierung“, „Sensationalisierung“ oder „Boulevardisierung“ manifestieren diese weit verbreitete Auffassung. An die Stelle politischer Inhalte sind oft „entpolitisierte“ Themen getreten.
Kerstin Reinisch fragt in ihrer Promotionsschrift (Universität Passau), ob und inwieweit eine Entpolitisierung in der deutschen Wahlkampfberichterstattung festzustellen ist. Dazu analysiert sie drei überregionale Qualitätszeitungen (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Die Zeit), die Bild-Zeitung als Boulevard-Blatt sowie zwei Regionalzeitungen (Passauer Neue Presse, Sächsische Zeitung). Die Autorin wertet über 4.700 Artikel aus, die jeweils in den vier Wochen vor den Bundestagswahlen 1953, 1972, 1983, 2002 und 2013 in diesen Zeitungen veröffentlicht wurden.
Das Buch liefert Antworten auf einige bislang offene Fragen. So lag der Umfang „entpolitisierter“ Berichte bei der Wahl 1953 bei 15 Prozent (gemessen an der gesamten Wahlkampfberichterstattung) und erreichte das (bisherige) Maximum im Wahljahr 2013, in dem die Autorin mehr als ein Viertel der Artikel als „entpolitisiert“ kodiert. Als entpolitisierte Artikel zählen Berichte über die Wahlkampforganisation und die Knappheit des Wahlausgangs („horse-race-journalism“), personenbezogene Berichte („Celebrity-Stories“) sowie „Rund-um-die-Wahl-Berichte“. Die Autorin bilanziert, der „Umfang der Wahlkampfberichterstattung schwankt abhängig vom historischen Kontext des jeweiligen Jahres“ und unterliege „keinem Trend in eine Richtung“ (158). Diese Schlussfolgerung scheint etwas irreführend, denn basierend auf Reinischs Daten scheint sich der Anteil entpolitisierter Inhalte – mit Ausnahme der Wahl 1972 – stetig leicht erhöht zu haben.
Das Hauptproblem der Studie liegt – trotz der beeindruckenden Anzahl an kodierter Artikel – in der Tatsache, dass „nur“ fünf Wahlen untersucht werden. Rückschlüsse basierend auf fünf Beobachtungen sind daher mit Vorsicht zu genießen. Beispielsweise bemerkt Kerstin Reinisch, der Umfang des „horse-race-journalism“, also Berichte über Umfragen und Auffassungen über Kandidaten, hänge von der Knappheit des Wahlausgangs ab. Aus den Abbildungen geht jedoch hervor, dass das Wahljahr stark mit der Anzahl an „horse-race“-Artikeln korreliert. Ein Regressionsmodell, das den Einfluss des Wahljahres an sich erfasst, würde den vermuteten Effekt des Wahlausgangs deutlich relativieren.
Das reiche Datenmaterial hätte außerdem für noch vertiefendere Inhaltsanalysen genutzt werden können. Die Autorin beschränkt sich auf die Kategorisierung in die vier Unterbereiche der entpolitisierten Berichterstattung und auf die Messung der Anschläge pro Artikelkategorie. Eine quantitative Inhaltsanalyse der Artikel findet nicht statt. So bleibt unbeantwortet, wie sich beispielsweise der Ton in der Wahlkampfberichterstattung geändert hat oder ob entpolitisierte Beiträge für gewisse Parteien häufiger auftreten. Beziehen sich entpolitisierte Artikel eher auf die Unionsparteien und die SPD, deren Kanzlerkandidat*innen im medialen Mittelpunkt stehen, oder sind die kleineren Parteien gleichermaßen von diesen Tendenzen betroffen? In einem nächsten Schritt wäre es interessant und wichtig zu erfahren, wie sich die Wortwahl in den Zeitungen verhält und sich im Laufe der Zeit geändert hat. Wären die Rohtexte aller Artikel in einem Korpus verfügbar, könnten derartige Analysen in einer zukünftigen Studie mittels quantitativer Textanalyse automatisiert werden.
Auch der Aspekt des Online-Journalismus hätte vertieft werden können. Die Autorin zeigt grafisch eindrucksvoll, dass den Online-Medien in den vergangenen Jahren eine immer größere Rolle zukommt. Doch wie berichten populäre Online-Portale im Vergleich zu etablierten Printmedien über Wahlkämpfe? Die Sächsische Zeitung wurde nur für zwei Wahlen kodiert (2002 und 2013) und fließt deshalb nicht in alle Analysen ein. Anstelle dieser Zeitung hätte beispielsweise ein Portal wie „Spiegel Online“ kodiert werden können, um die Entpolitisierung auf Websites mit Printmedien zu vergleichen. Außerdem vergleicht Reinisch die Ergebnisse kaum mit denen der Medienforschung über andere etablierte Demokratien. Die meiste verwendete Literatur stammt von deutschen Autor*innen. Selbst über die Amerikanisierung der Wahlkämpfe finden sich kaum englischsprachige Publikationen.
Die deskriptiven Analysen stellen eine große Bereicherung für die deutsche Wahl- und Kommunikationsforschung dar. Glücklicherweise scheint die große Mehrheit der Wahlberichterstattung noch immer politische Inhalte zu beinhalten. Dass „die vorliegende Studie keinen Trend zu mehr Entpolitisierung“ (345) findet, ist aus demokratietheoretischer Sicht begrüßenswert. Allerdings zeigen die obigen Kritikpunkte, dass derartige Schlussfolgerungen erst dann gezogen werden können, wenn mehr als fünf Wahlen analysiert und die Inhalte der Artikel noch genauer untersucht werden. Insgesamt bietet das Buch viele Anknüpfungspunkte für vertiefende Projekte an der Schnittstelle zwischen Wahl- und Kommunikationsforschung, von denen einige über den Rahmen einer Dissertation hinausgehen.