Björn Hacker: Weniger Markt, mehr Politik. Europa rehabilitieren
16.01.2020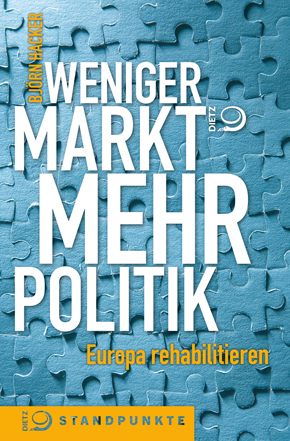
Björn Hacker verfolgt mit seinem Buch, einer gelungenen Mischung von Analyse und Denkschrift, die Absicht, den Prozess der europäischen Integration gegenüber zahlreichen Krisendiagnosen linker oder rechter Spielart als zukunftsweisendes Projekt zu rehabilitieren. Eine durchgehende Prämisse seiner Überlegungen ist die Überzeugung, die Europäische Union werde vom „Sündenbock zum Problemlöser“ (22), wenn sie sich in ihren Verfahren von der heute dominierenden Marktgläubigkeit lösen und zu dem Modus der Politikgestaltung zurückkehren könne, der in der Gründungsphase der europäischen Integration Geltung hatte. Als Referenz verweist Hacker auf die von Jean Monnet in den 1950er-Jahren initiierte Methode sektoraler Vergemeinschaftung, die – jenseits funktionalistischer Annahmen eines eigengesetzlich ablaufenden Prozesses – auf schrittweise Kompromisse setzte. Mit diesem Bezug ist auch die konzeptionelle Anlage des Buches verbunden: Der Autor plädiert für einen reformistischen Realismus, der die Potenziale der bestehenden institutionellen Architektur zumal der Eurozone im Sinne einer „European Politics against global Markets“ (241) nutzt. Zum Realismus gehört für Hacker, weder die strukturellen Probleme der EU noch die einschlägigen medialen Krisendebatten in simplifizierende Fragen vom Typus Für oder gegen Europa? zu überführen (20). Er wählt stattdessen eine Analyse in drei Schritten, die zunächst das verbreitete, vielfach diffus bleibende Unbehagen von Bürgerinnen und Bürgern mit dem Stand der europäischen Integration aufgreift, dem folgt eine Auseinandersetzung mit wesentlichen Konfliktfeldern europäischer Politik und abschließend entwirft er Grundzüge einer europäischen Politikgestaltung.
Europäisches Unbehagen – wirtschaftlich, gesellschaftlich, politisch
Für die unterschiedlichen Ausprägungen der Unzufriedenheit mit der europäischen Integration macht Hacker– darin steht er zweifellos nicht allein – den sich seit den 1980er-Jahren ausbreitenden Neoliberalismus verantwortlich. Im Zuge des Thatcherismus und der Reagonomics wurden binnen eines Jahrzehnts die realwirtschaftlichen gegen finanzkapitalistische Spielregeln ausgetauscht. Ab 2000 erlebte Deutschland unter der Regierung Schröder mit der Privatisierung staatseigener Unternehmen, der Alterssicherung und im Finanzsektor eine einschneidende Liberalisierungswelle. Auf ganzer Breite vollzog sich in Europa seit den 1990er-Jahren ein Abschied vom korporatistischen Sozialmodell: „Immer ging es dabei um eine Anpassung der vorgefundenen Sozialsysteme, des Arbeitsmarktes und der Wirtschaftspolitik an die Bedingungen einer als Externalität wahrgenommenen Globalisierung, nie um die Gestaltung dieser Globalisierung entlang den Prioritäten der Wohlfahrtsstaaten.“ (40 f.) Komplementär dazu dominierten Verfechter der Marktschaffung in der Reaktion auf die Eurokrise; die namentlich von Deutschland durchgesetzte Linie, Staatsverschuldung als zentrales Problem zu behaupten, wirkte krisenverschärfend und förderte makroökonomische Ungleichgewichte zwischen den Mitgliedstaaten. Gerade angesichts eines entgrenzten Finanzkapitalismus und zunehmender sozialer Spaltung Europas bietet die EU das Bild struktureller Reformunfähigkeit. Darauf reagieren Gegenbewegungen einer globalisierungs- und kapitalismuskritischen Linken und – allerdings ungleich wirkungsvoller – eines xenophoben Nationalismus, der sich aggressiv gegen Migranten, internationale Kooperation und demokratischen Liberalismus wendet. Den dahinterliegenden Motiven schreibt Hacker eine Überlagerung von Ängsten vor Prekarität, empfundenen Kontrollverlusten und kulturellen Konflikten zu (50 ff.).
Falsche Antworten von links und rechts
Nach den beiden großen Integrationsprojekten Osterweiterung und Währungsunion verharrt die EU in einer Phase der Stagnation, die in unterschiedlicher Ausprägung rechts wie links Tendenzen einer „Re-Inthronisation des Nationalstaates“ hervorruft (93). Die rechten Parolen gegen das vermeintliche europäische Politikkartell variieren die bekannten Muster populistischer Elitenkritik und entwerfen ein Europa als Zollunion ohne gemeinsame Währung und mit stark eingeschränkter Personenfreizügigkeit. Und EU-weit sind bei konservativen Parteien rhetorische Anbiederungen an rechtspopulistische Parolen eines ‚taking back control’ zu beobachten – mit desaströsen Folgen wie im britischen Fall des Brexits. Aber auch sozialdemokratische und linke Parteien erweisen sich – um mit der dänischen Socialdemokratiet und der Bewegung „La France insoumise“ nur zwei Beispiele zu nennen – nicht als immun gegenüber einer nationalistischen Diskursverschiebung. Vor diesem Hintergrund setzt sich Hacker vehement mit unterschiedlichen Spielarten eines „linken Realismus“ auseinander (109 ff.), der zur Abwehr der unübersehbaren Erfolge des rechten Populismus für einen linken Populismus votiert, mehr wirtschaftliche und fiskalische Souveränität für den Nationalstaat fordert und sich vom „progressiven Neoliberalismus“ urbaner Mittelschichten abgrenzen will (vgl. Geiselberger 2017, van Dyk/Graefe 2019). Hier ist sein Urteil eindeutig: „[D]er Glaube an eine Renaissance nationalstaatlicher Steuerungskapazitäten unter Missachtung grenzüberschreitenden Regulierungsbedarfs wird in einer heute um ein Vielfaches interdependenter gewordenen Welt unweigerlich zum Scheitern verurteilt sein“ (120). Statt hochfliegender Pläne eines radikalen Umbaus der EU in Richtung europäischer Bundesstaatlichkeit seien heute konkrete Vorschläge zur Rückgewinnung ihrer politischen Gestaltungskapazität erforderlich (177).
Konfliktfelder und Handlungsmöglichkeiten
Hacker begründet diese Einschätzung durch eine Diskussion zentraler und peripherer Konfliktfelder der europäischen Krise, die sich weitgehend einer simplifizierenden Einengung auf die vermeintliche Wahl zwischen mehr oder weniger Integration entziehen. Zu den eher peripheren Konfliktfeldern zählt er beispielsweise Fragen der nationalen beziehungsweise supranationalen Kompetenzverteilung und – auffällig – auch solche der demokratischen Legitimation; peripher deshalb, weil die EU einerseits bei etlichen strittigen Punkten in der Praxis über einen modus vivendi verfügt, „der zwar niemanden in Gänze befriedigt, aber gut funktioniert“ (128). Andererseits aber bleiben für ihn Forderungen eines demokratischen Republikanismus – wie sie nachdrücklich von Ulrike Guérot (2016) vertreten werden – die Antwort schuldig, ob und wie damit zugleich die Dominanz des Marktliberalismus überwunden werden könnte (172 f.). Das Konfliktfeld Ökonomie ist gerade deshalb von zentraler Bedeutung, weil die Beibehaltung des Markt- und Wettbewerbsmantras die bestehende Ungleichheit unter den Mitgliedstaaten verstärkt. Hacker verweist auf den Streit zwischen den von Deutschland angeführten Verfechtern einer regelbasierten Stabilitätsunion, die im Kern eine krisenverschärfende Austeritätspolitik für die wirtschaftlich schwächeren Länder bedeutet, und den von Frankreich angeführten Befürworten einer Fiskalunion, die perspektivisch zu einer europäischen Wirtschaftsregierung führen könnte. Ansätze für eine ausdrücklich politische Steuerung der Währungsunion sind bereits vorhanden (Europäisches Semester, Eurogruppe, Makroökonomischer Dialog), die allerdings in eine umfassende wirtschaftspolitische Koordinierung der Mitgliedstaaten (analog der in Deutschland in den 1960er-Jahren praktizierten Konzertierten Aktion) überführt werden müssen. Zur Eindämmung von makroökonomischen Ungleichgewichten sollte auf der Ebene der Mitgliedstaaten die verpflichtende Verfolgung des Grundsatzes „Nominallohnwachstum gemäß Produktivitätssteigerung plus Inflationsziel treten“ (188 f.).
Ein zweites zentrales Konfliktfeld stellt die unzureichend ausgebaute Sozialunion dar; eine substanzielle Annäherung der Lebensverhältnisse in den Mitgliedstaaten ist nur über eine Konvergenzpolitik erreichbar, die statt auf Marktschaffung auf Marktgestaltung setzt. Wichtige Schritte in diese Richtung wären einerseits die verbindliche Übernahme der Grundsätze der 2017 eingeführten Europäischen Säule sozialer Rechte (ESSR) in die Verträge und andererseits eine daraus abgeleitete Vereinbarung quantifizierter sozialer Mindeststandards und Zielwerte, die sich an den jeweiligen nationalen Kennwerten orientieren.
Die Entwicklung einer kohärenten, europäisch koordinierten Migrationspolitik bildet schließlich das dritte Konfliktfeld. Hacker schlägt hierzu einen „package deal“ vor, bei dem in einem ersten Schritt nationale Asylstandards angeglichen und Maßnahmen des Außengrenzschutzes verbessert werden. Dem müsste dann die Einrichtung von legalen Zugangswegen der Wirtschaftsmigration in die europäischen Arbeitsmärkte folgen, wobei die Mitgliedstaaten eigene Gestaltungsspielräume hätten. Notwendig wäre aber ebenso, die Integration von Zugewanderten durch einen Gemeinschaftsfonds zur Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen systematisch zu verbessern. Der Ausbruch aus der bisherigen Blockade in der Verteilung von Geflüchteten sei nämlich nur möglich, wenn „die Integrationsprobleme vor Ort nicht länger dem marktlichen Wettbewerb zwischen Immigranten und Aufnahmegesellschaft überantwortet werden“ (213).
Literatur
Dyk, Silke van; Graefe, Stefanie (2019): Wer ist schuld am Rechtspopulismus? Zur Vereinnahmung der Vereinnahmungsdiagnose: eine Kritik. In: Leviathan 47. Jg., Heft 4, S. 405- 427.
Geiselberger, Heinrich (Hg) (2017): Die große Regression. Eine internationale Debatte über die geistige Situation der Zeit. Berlin edition suhrkamp.
Guérot, Ulrike (2016): Warum Europa eine Republik werden muss. Eine politische Utopie. Bonn J.H.W. Dietz Nachf.
