Jeffrey D. Sachs: A New Foreign Policy. Beyond American Exceptionalism
06.05.2019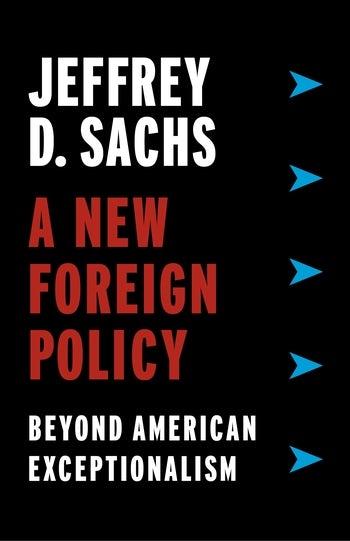
Eine neue Außenpolitik. Jenseits des US-amerikanischen Exzeptionalismus
Armutsbekämpfung, Klimawandel, nachhaltiges Wirtschaftswachstum, Terrorismus, Cybercrime, die Liste der neuzeitlichen Herausforderungen ist lang – und Staaten sind alleine kaum mehr in der Lage, Lösungen für diese Probleme zu finden. In diesem Zusammenhang betrachtet Jeffrey D. Sachs, Entwicklungsökonom an der Universität Columbia/USA, die amerikanische Außenpolitik.
Amerika habe sich lange Zeit als eine Ausnahmenation (God‘s chosen nation) betrachtet. Diese Selbstwahrnehmung sei mit Blick auf die Besiedlung Amerikas historisch zu erklären, habe aber zu einer Reihe von außenpolitischen Entscheidungen geführt, die den Vereinigten Staaten geschadet hätten. Dazu gehörten alleine im 20. Jahrhundert Kriege wie in Vietnam, Regimewechsel im Iran, Sanktionsregime gegen missliebige Staaten (aus wirtschaftlichen oder geostrategischen Gründen). Diese exzeptionalistische Außenpolitik sei anachronistisch, auch wenn mit Donald Trump, dem 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten, ein Vertreter dieser Richtung (America First) an der Macht sei.
Jeffrey Sachs dagegen schreibt sich einer außenpolitischen Schule zu, die er Internationalismus (internationalism) nennt. Anhänger dieser außenpolitischen Richtung nehmen an, dass globale Probleme nur durch Kooperation zu lösen seien, dass eine Politik der Stärke und Aufrüstung die Problemlösung erschwere und dass anstelle eines Win-loose-Nationalismus nur ein Win-win-Multilateralismus zwischen Staaten erfolgreich sein könne. Militärische Macht (military power) lehnt er nicht ab, sie stehe jedoch nicht im Vordergrund, anders als Vertrauen schaffende gemeinsame globale Werte.
In einem kurzen Überblick stellt Sachs die historische Entwicklung der Weltbevölkerung und des welt-ökonomischen Outputs vor. Was die Bevölkerung angeht, sei Asien, insbesondere China, mehr als vier Mal so groß wie die Vereinigten Staaten. Allerdings würde aufgrund der Ein-Kind-Politik auch dort ab Mitte des 21. Jahrhunderts eine Bevölkerungsminderung eintreten. Afrika hingegen würde China bis zum Ende des Jahrhunderts hinsichtlich des Anteils an der Weltbevölkerung deutlich übertreffen. Auch ökonomisch lässt sich der relative Bedeutungsverlust der Vereinigten Staaten anhand des sinkenden Anteils der Industrieproduktion und des Anteils am Welthandel erkennen.
Insofern warnt Sachs die amerikanische Außenpolitik davor, sich weiter zu isolieren. Die „neue Seidenstraße“ (road and belt initiative) ist für ihn ein Beispiel gelungener Kooperation. Sie zeige die Möglichkeiten Win-win-orientierter-Wirtschaftspolitik durch China, mache aber auch die Gefahren deutlich, die entstehen, wenn sich die durch die US-amerikanische Außenpolitik ‚verprellte‘ EU weiter nach Asien orientiert. Gleiches gelte für die von China angeführte Kooperation zur Schaffung eines Netzverbunds für erneuerbare Energien (Global Energy Interconnection Cooperation and Development, GEIDCO).
Sachs greift auf seine eigenen Erfahrungen als Wirtschaftsberater von Präsident Gorbatschow zurück, wenn er das Verhalten der Vereinigten Staaten gegenüber Russland in den 1990er-Jahren kritisiert. Der Regimewechsel in Russland hin zu einer demokratisch gewählten Regierung sei von den Vereinigten Staaten nicht gewürdigt worden. Als es in Russland im Rahmen der Transformation hin zu einer Marktwirtschaft zu finanziellen Schwierigkeiten gekommen sei, hätten die USA nicht helfend eingegriffen. Hinzu komme die Ausbreitung der NATO bis an die russischen Grenzen, die Russland in eine Abwehrhaltung getrieben habe. Dies seien zwei Wurzeln des neuen Konflikts zwischen den USA und Russland.
Die amerikanische Außenpolitik habe durch ihre fortwährenden kriegerischen Aktivitäten vor allem negatives Ansehen errungen. Hierzu zählt Sachs insbesondere die Aktivitäten der CIA im Mittleren Osten (zum Beispiel Syrien und Libyen) oder in Lateinamerika (zum Beispiel Guatemala und Nicaragua). Er nennt diese Konflikte auch Kriege nach eigenem Ermessen (wars of choice), mithin Auseinandersetzungen, denen die USA auch hätten fernbleiben können. Der Glaubwürdigkeit amerikanischer Außenpolitik dienend, so Sachs, sollten alle diese Auseinandersetzungen von den Vereinigten Staaten sofort beendet werden.
Sachs betont die Kontinuität der Außenpolitik der US-amerikanischen Präsidenten. Eine Ausnahme sei J. F. Kennedy, der durch angemessene Rhetorik insbesondere im Kalten Krieg mit Russland deeskalierend wirkte. Dem derzeitigen Präsidenten Donald Trump stellt er hingegen ein schlechtes Zeugnis aus. Seine Einlassungen im Israel-Palästina-Konflikt die Verlegung der US-amerikanischen Botschaft nach Jerusalem, habe dem, was einmal als Zweistaatenlösung geplant war, einen herben Schlag versetzt. Seine kriegerische Rhetorik gegenüber den Palästinensern lasse die Lösung des Konflikts immer schwieriger erscheinen. Auch in Bezug auf Nord-Korea sei durch die Impulsivität des amerikanischen Präsidenten die Gefahr einer nuklearen Eskalation deutlich gestiegen. Nicht zuletzt bergen die Handelsstreitigkeiten mit China, einem Land, das durch die nationale Sicherheitsstrategie als zu bekämpfender Wettbewerber eingeordnet werde, ein großes Konfliktpotenzial.
Ob Trumps nationalistische America-First-Politik ökonomische Erfolge erzielen wird, sei unsicher. Sachs jedenfalls bezweifelt deren Sinnhaftigkeit. Positive Effekte, wie zum Beispiel die Rückverlagerung von Produktionsjobs in die Vereinigten Staaten, seien höchst unwahrscheinlich. Im Gegensatz zu Trumps Politik schlägt Sachs eine auch auf technologischer Ebene kooperative Haltung der USA zu China vor. So würden beide Länder von einem liberalisierten Handel profitieren. Sollte die USA weiterhin ihre außenpolitische Doktrin beibehalten, würde sie wohl irgendwann als Schurkenstaat (rogue nation) enden und von der politischen und ökonomischen Entwicklung in Asien abgekoppelt sein.
Sachs schlägt verschiedene Möglichkeiten vor, die Lage zum Besseren zu wenden. Dazu gehört ein stärkeres (auch finanzielles) Engagement der Vereinigten Staaten in den Vereinten Nationen. Die USA sollten ausstehende Konventionen ratifizieren (zum Beispiel für den internationalen Strafgerichtshof) und sich wieder dem Pariser Klimaabkommen anschließen. Weiterhin sollten die Vereinigten Staaten ihre Mittel zur Entwicklungshilfe aufstocken, um ärmere Staaten weltweit zu unterstützen. Die USA sollten wieder zu einem offenen Land werden, indem Migration an die ökonomischen Notwendigkeiten des Landes angepasst wird. Willkürliche Reiseverbote (travel bans) gegen islamische Staaten seien kaum hilfreich. Nicht zuletzt sollte die Agenda 2030 mit ihren nachhaltigen Entwicklungszielen unterstützt und umgesetzt werden.
Mit seinen Vorschlägen einer neuen amerikanischen Außenpolitik präsentiert Sachs vor allem eine Kritik an der bisherigen Außenpolitik US-amerikanischer Präsidenten, insbesondere an der Donald Trumps. Die Notwendigkeiten einer verstärkten zwischenstaatlichen Kooperation klingen für europäische Ohren nicht neu, überhaupt sind die in diesem Band versammelten Gedanken keineswegs so überraschend und provozierend, wie es im Klappentext angekündigt wird. Das macht sie aber keineswegs weniger relevant. Wie die Ziele konkret umgesetzt werden könnten, lässt Sachs offen. Dennoch bietet er einen guten Überblick über die Probleme und politischen Strömungen US-amerikanischer Außenpolitik im 21. Jahrhundert.
