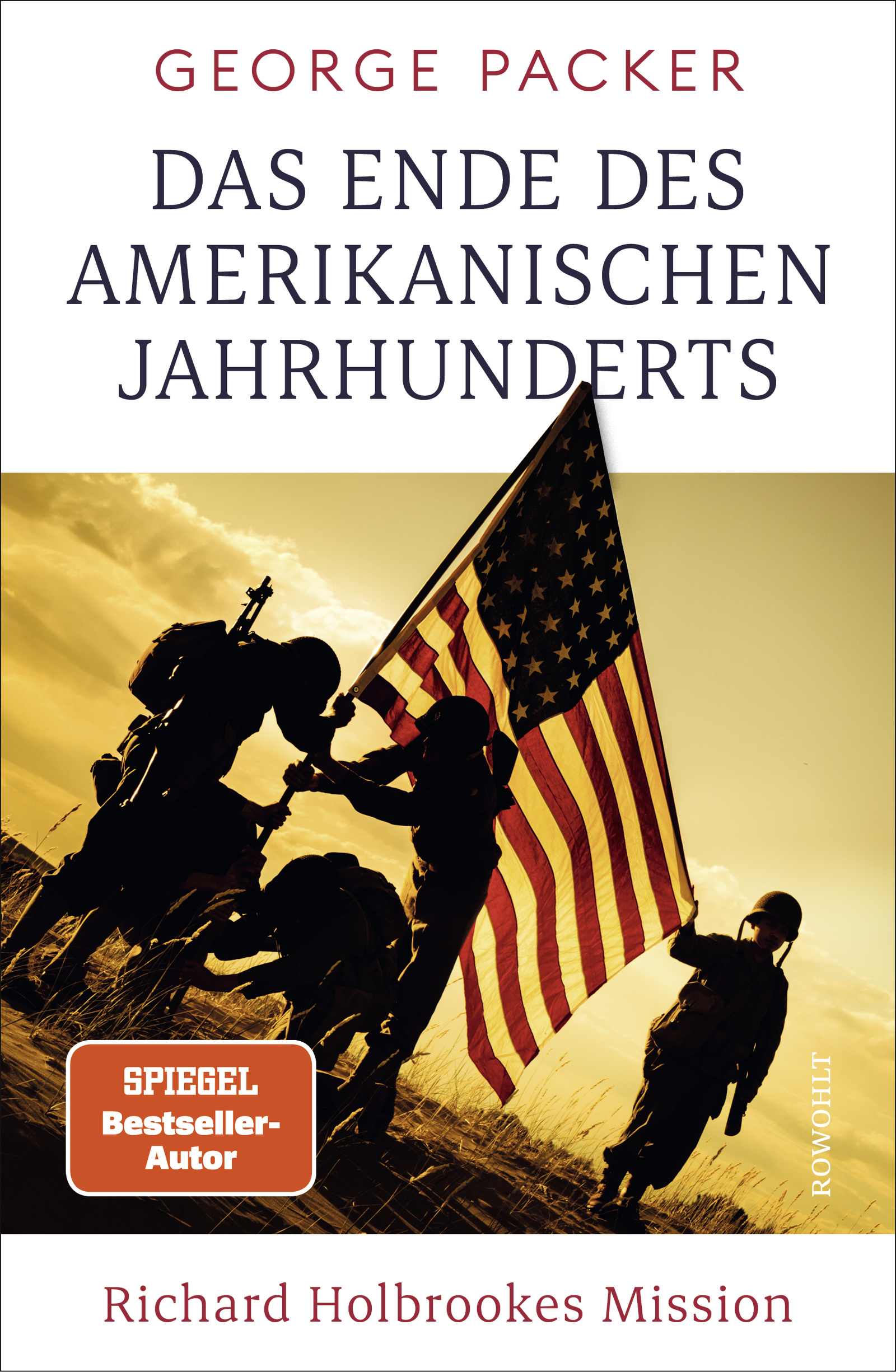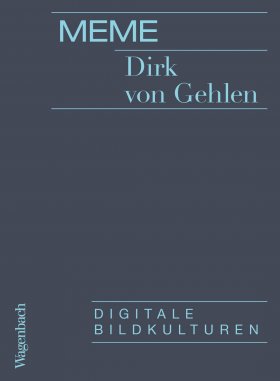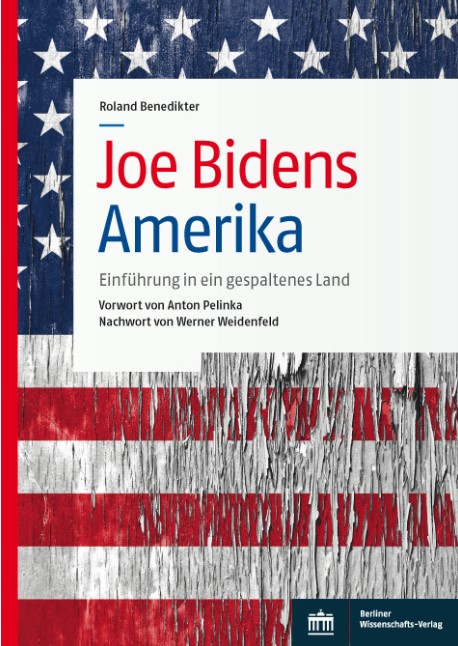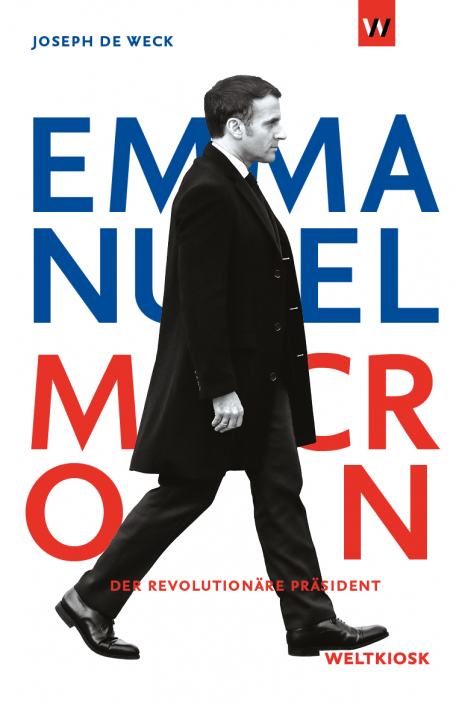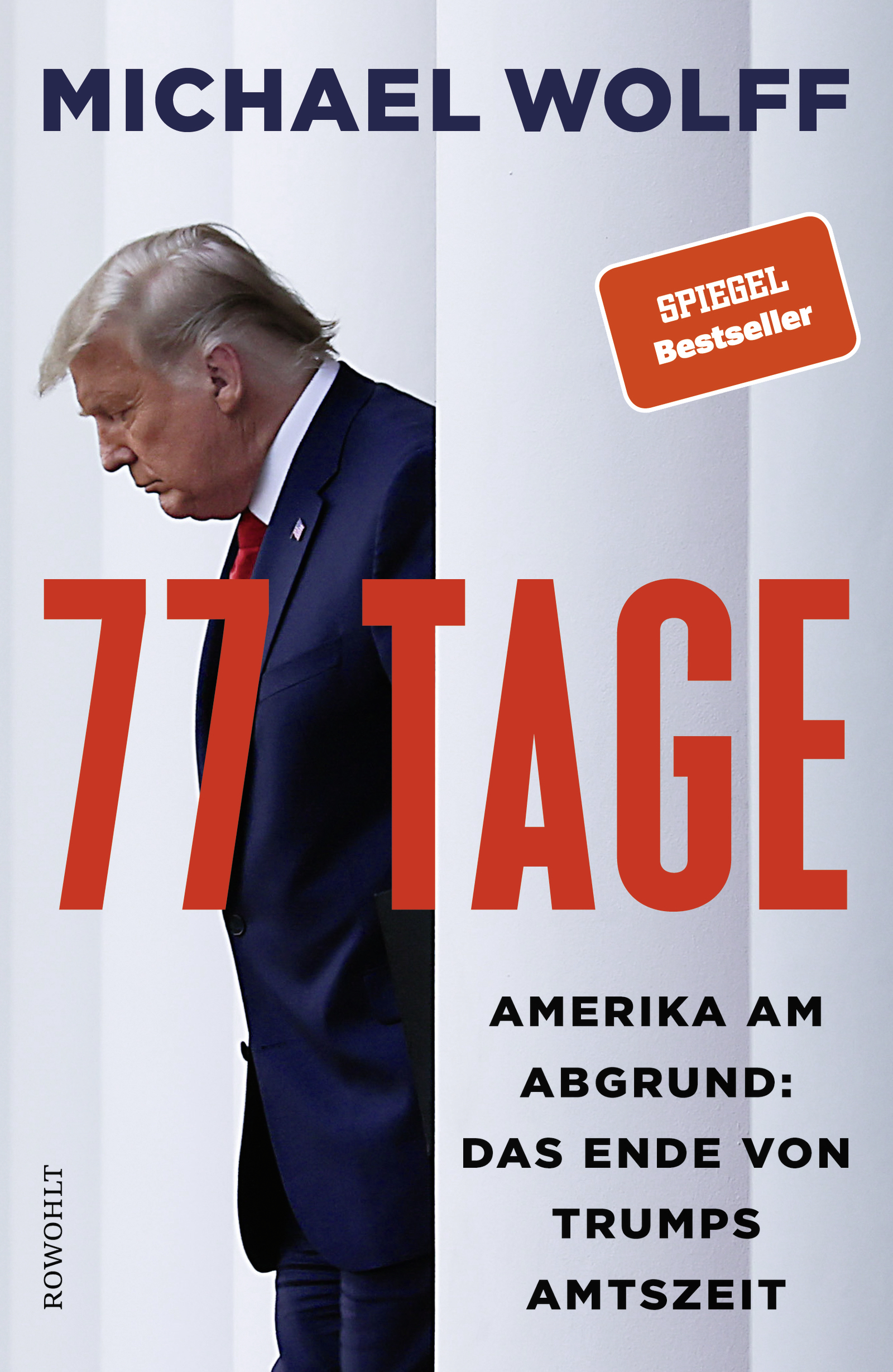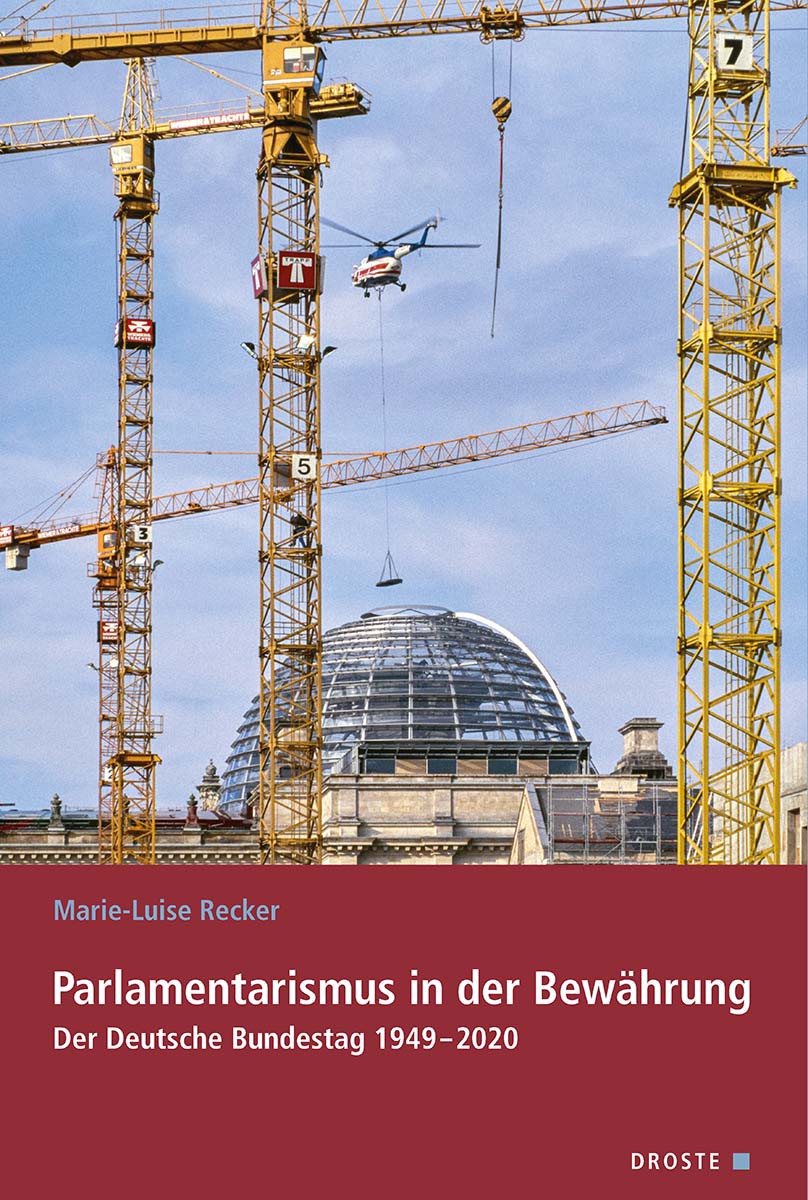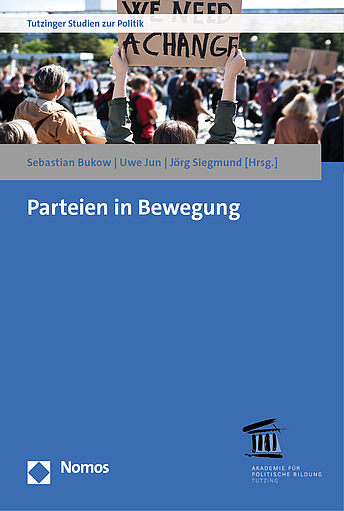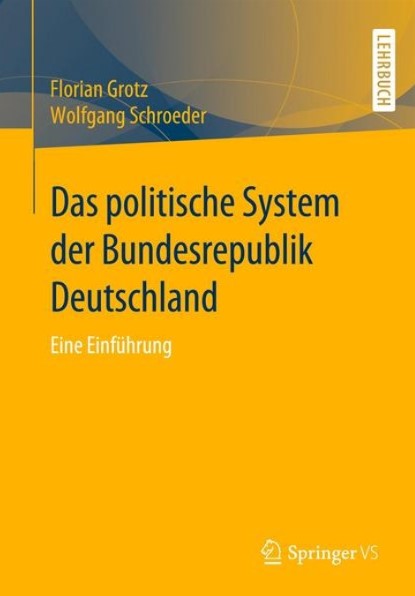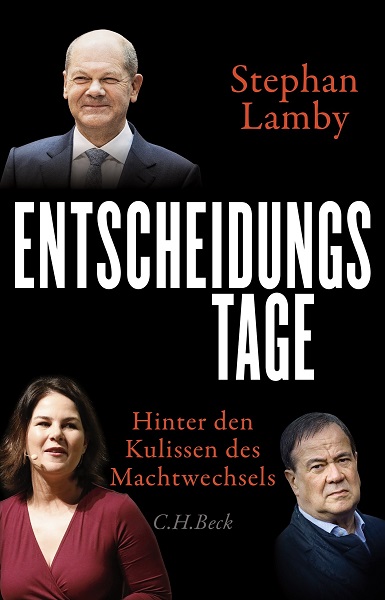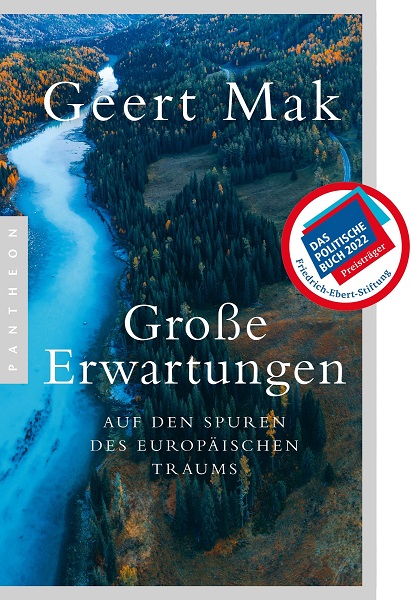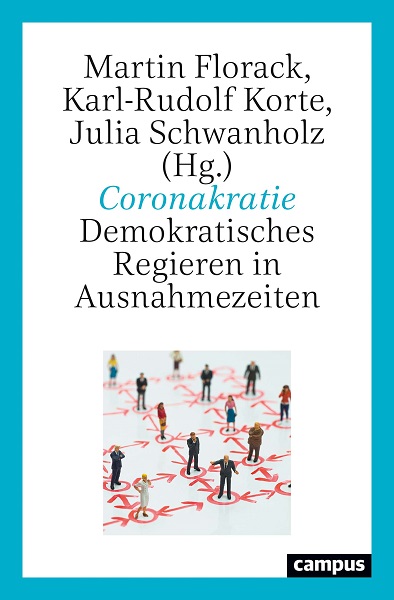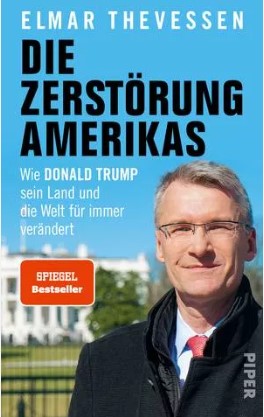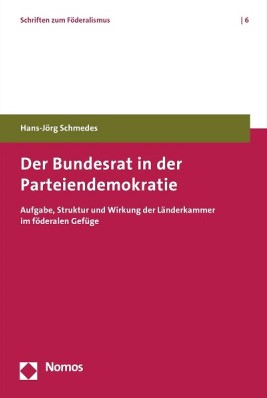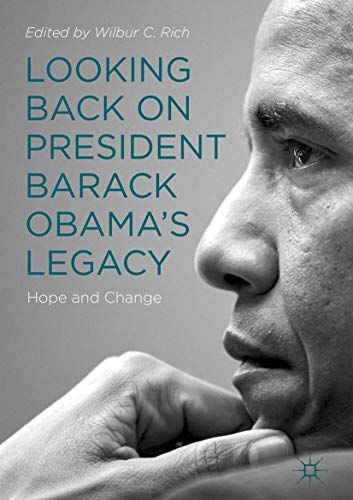Gerhard Paul: Die Bundesrepublik. Eine visuelle Geschichte
Der Historiker Gerhard Paul hat mit seiner visuellen Geschichte der Bundesrepublik ein Buch vorgelegt, das unseren Rezensenten Michael Kolkmann vollends begeistert. Anhand zahlreicher Fotos und ausführlichen Begleittexten sei es Paul, einem der wichtigsten Vertreter der „visual history“, gelungen, eine umfassende Politik-, Sozial- und Kulturgeschichte seit 1949 zu entwerfen. Das Ergebnis sei ein „phänomenales Werk“, das politikwissenschaftlich in viele Richtungen anschlussfähig sei. Für Kolkmann aber mindestens ebenso wichtig: Selten habe die Beschäftigung mit Geschichte so viel Spaß gemacht.
About Caucuses and Primaries – Wer kandidiert für das Präsidentenamt in den USA?
Wer wird der nächste US-Präsident? Diese Frage beantworten die US-amerikanischen Wählerinnen und Wähler in der General Election am 5. November 2024. Wer dann zur Wahl steht, entscheidet sich im Vorwahlprozess, der am 15. Januar 2024 in Iowa beginnt. Bürger und Parteimitglieder der Bundesstaaten sind in Primaries und Caucuses aufgerufen ihren „Frontrunner“ zu küren. Der amtierende Präsident Joe Biden, hat mit seinen 81 Jahren bereits im April 2023 seine erneute Kandidatur für die demokratische Partei angekündigt. Besonders interessant gestaltet sich das Rennen bei den Republikanern, wo noch nicht endgültig feststeht, wer die Grand Old Party in diesem Jahr auf dem Wahlzettel repräsentieren wird. Gemeinsam mit Michael Kolkmann (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) wirft das Institut für Parlamentarismusforschung (IParl) einen Blick auf den Vorwahlprozess und das Feld der Bewerberinnen und Bewerber.
Martin Fuchs, Martin Motzkau: Digitale Wahlkämpfe. Politische Kommunikation in der Bundestagswahl 2021
Der Sammelband behandelt die digitalen Wahlkämpfe im Bundestagswahljahr 2021. Die Beitragsautor*innen beleuchten erfolgreiche Kampagnen, Parteien und Kandidat*innen, die von digitaler Kommunikation profitierten und analysieren hierzu Plattformen, Formate, Strategien und das Kommunikationsverhalten der Parteien im Bundestagswahlkampf: Phänomene wie Twitter-Kommunikation, Data-Driven Campaigning, Nudging, Hate Speech und Memes wurden dabei (zumeist empirisch) untersucht. Den Beiträgen gelinge es so, mittels zentraler Ergebnisse Impulse für die weitere Forschung zu setzen, lobt unser Rezensent.
Uwe Jun, Oskar Niedermayer: Die Parteien nach der Bundestagswahl 2021. Neueste Entwicklungen des Parteienwettbewerbs in Deutschland
Die politikwissenschaftliche Aufarbeitung der Bundestagswahl 2021 wird durch ein weiteres Standardwerk ergänzt. Oskar Niedermayer und Uwe Jun präsentieren in dem von ihnen herausgegebenen Sammelband eine systematische Bestandsaufnahme der parteipolitischen Entwicklungen seit der Bundestagswahl. Neben Kapiteln zu allen relevanten Parteien werden auch die Grundlagen und die programmatische Seite des Parteienwettbewerbs behandelt. Michael Kolkmann lobt, das Buch als eine „wahre Fundgrube“ für Parteienforscher*innen, die „auf absehbare Zeit nicht übertroffen werden dürfte“.
Karl Schlögel: American Matrix. Besichtigung einer Epoche
Karl Schlögel reiht sich mit seinem Buch „American Matrix“ ein in die große Tradition intellektueller europäischer Reiseberichterstatter über die USA: Als Osteuropahistoriker zieht er dabei nicht nur erkenntnisreiche Vergleiche zu seinem eigenen Forschungsgebiet, sondern versucht, die USA als „Raum“ zu erfassen. Dies gelingt ihm laut unserem Rezensenten Michael Kolkmann auf besondere Weise: Mit seinen Streifzügen von Baseballstadien über Einkaufszentren und Highways bis hin zu den Schlachthöfen Chicagos lädt das Buch dazu ein, „nach Herzenslust zu blättern und zu stöbern“.
Alexander Thiele: Das Grundgesetz. Verständlich erklärt
Anlässlich des 75-jährigen Jubiläums des Verfassungskonvents von Herrenchiemsee hat der Staatsrechtler Alexander Thiele eine Einführung vorgelegt, die als „Anregung zum Nachlesen und Erkunden der einzelnen Abschnitte und zum Nachdenken über das Grundgesetz“ dienen soll. Neben der Erläuterung einzelner Artikel nimmt Thiele sowohl die Entstehung und Entwicklung des Grundgesetzes als auch das politische System der Bundesrepublik in den Blick. Herausgekommen ist ein verständlich geschriebener Lektüreleitfaden, der unseren Rezensenten Michael Kolkmann zum Weiterlesen anregt.
Stephan Lamby: Ernstfall: Regieren in Zeiten des Krieges. Report aus dem Inneren der Macht
Der Journalist Stephan Lamby hat die wichtigsten Akteure des politischen Berlins seit dem russischen Angriff auf die Ukraine aus nächster Nähe beobachtet. Er schildert, wie die Bundesregierung den Kriegsausbruch erlebte, was der „Zeitenwende“-Rede von Olaf Scholz vorausging und warum zwischen Robert Habeck und Christian Lindner eine „Aufmerksamkeits-Konkurrenz“ ausbrach. Dank zahlreicher Gespräche und exklusiver Einblicke gelingt Lamby ein kenntnisreicher Blick hinter die Kulissen, der für „jede weitergehende Beschäftigung mit der Ampel-Regierung (…) unverzichtbar sein wird“, so Michael Kolkmann.
Timothy Garton Ash: Europa. Eine persönliche Geschichte
Der renommierte britische Historiker Timothy Garton Ash hat mit „Europa. Eine persönliche Erinnerung" ein voluminöses Buch vorgelegt, das einer Art Lebenswerk gleichkommt. Anhand von kleinen Erzählungen und Gesprächen mit Protagonist*innen veranschaulicht der leidenschaftliche Europäer die großen Entwicklungen des Kontinents und schreibt so seine persönliche europäische Nachkriegsgeschichte. Rezensent Michael Kolkmann ist begeistert: Das Werk sei ein „kurzweiliges und vielschichtiges Lesevergnügen“ und zähle schon jetzt zu den „wichtigsten Sachbüchern“ des Jahres.
Sabine Adler: Die Ukraine und wir. Deutschlands Versagen und die Lehren für die Zukunft
Wie kam es zum Ukraine-Krieg und welche Fehler haben Deutschland und die Europäische Union begangen? Sabine Adler gibt Antworten auf diese Fragen, indem sie das aktuelle Kriegsgeschehen in der Ukraine in einen größeren geografischen und historischen Kontext stellt. Sie kritisiert unter anderem die Nord-Stream-Abkommen sowie Deutschlands Geschichtsvergessenheit gegenüber der Ukraine. Rezensent Michael Kolkmann lobt Adlers Werk als lesenswertes, kurzweiliges und kenntnisreiches Buch.
George Packer: Das Ende des amerikanischen Jahrhunderts
George Packer gelingt in seinem Buch das Kunststück, die Nachkriegsgeschichte der USA anhand der Biografie eines einzigen Mannes zu erzählen. Richard C. Holbrooke war US-amerikanischer Spitzendiplomat, Architekt des Dayton-Abkommens, das 1995 den Bosnienkrieg beendete, und wäre mehrmals fast Außenminister geworden. Anhand Holbrookes beruflicher Stationen, aber auch seiner charakterlichen Stärken und Schwächen seziert Packer die Erfolge und Fehler US-amerikanische Außenpolitik und erzählt die Geschichte vom Aufstieg und Ende des „US-amerikanischen Jahrhunderts“ nach.
Dirk von Gehlen: Meme. Muster digitaler Kommunikation
Dirk von Gehlen untersucht hier ein populäres (Klein-)Format, an dem auch das Politische im Netz längst nicht mehr vorbeikommt. Dabei stellt er unter anderem vier größere Entwicklungslinien innerhalb der öffentlichen (digitalen) Debatte vor, die auch Memes als Bestandteile der politischen Kommunikation auszeichneten: Popularisierung, Polarisierung, Personalisierung und Prozess, so unser Rezensent Michael Kolkmann. Das Internet habe damit einen spezifischen digitalen Dialekt entwickelt, dessen Voraussetzungen und Funktionsweisen der Autor kurzweilig und kreativ zu behandeln verstehe.
Die US-amerikanischen Zwischenwahlen vom 8. November 2022: Vorgeschichte, Ergebnisse, Konsequenzen

Den Demokraten ist es gelungen, die Kontrolle über den Senat zu behalten, doch die republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus wird Biden das Regieren künftig erschweren. Bild: David auf Pixabay.
Was bedeutet das Ergebnis der US-amerikanischen Zwischenwahlen am 8. November 2022 für die Gestaltungsmacht von Joe Bidens Demokraten und für die Präsidentschaftswahl 2024? Michael Kolkmann analysiert die Ausgangslage, die wahlentscheidenden Themen, die Ergebnisse und die politischen Konsequenzen der Midterm Elections. Zwar sei es den Demokraten gelungen, die Kontrolle über den Senat zu behalten, doch die republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus werde Biden das Regieren in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit erschweren. Bei den Republikanern zeichneten sich nach dem Chaos um die Wahl des Sprechers des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, innerparteiliche Spannungen und ein Zweikampf um die Präsidentschaftskandidatur 2024 zwischen dem Ex-Präsidenten Donald Trump und dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis ab.
Roland Benedikter: Joe Bidens Amerika. Einführung in ein gespaltenes Land
Als „‚Scharnier-Präsident‘“ könnte Joe Biden möglicherweise im historischen Rückblick angesehen werden, der zwar keine historische Ära geprägt, aber die USA in einer für sie richtungsweisenden Übergangs- und Transformationsphase geleitet habe, schreibt Roland Benedikter. Ausgehend von einer Charakterisierung des aktuellen Präsidenten, kommt er auf die Strukturen und Akteure des Landes zu sprechen und bietet eine „‚Kurzeinleitung in den allgemeinen Zustand der US-amerikanischen Gesellschaft und Politik‘“. Laut Rezensent Michael Kolkmann ist so eine Zustandsbeschreibung der US-Demokratie entstanden.
Joseph de Weck: Emmanuel Macron. Der revolutionäre Präsident
Ein „jupiterhafter Präsident“ wolle er sein, der über dem politischen Klein-Klein schwebe, verkündete Emmanuel Macron nach der Wahl zum französischen Staatspräsidenten 2017. Ist es ihm gelungen? Joseph de Weck, Historiker und Politologe, stellt nicht nur die biografischen Prägungen Macrons nach, sondern benennt auch die gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen, wie die Bekämpfung der Pandemie, denen sich Macron zu stellen hat, und er beleuchtet seine politische Philosophie. Dabei werde deutlich, so Rezensent Michael Kolkmann, dass er eine Art „neuen politischen Akteur“ verkörpere – er sei „Monsieur ‚Weder-links-noch-rechts‘“.
Thomas Bernauer / Detlef Jahn / Sylvia Kritzinger / Patrick M. Kuhn / Stefanie Walter: Einführung in die Politikwissenschaft
Die bereits 2009 veröffentlichte Einführung in die Politikwissenschaft habe sich nach Meinung unseres Rezensenten Michael Kolkmann zu einem „Klassiker des Faches“ entwickelt. Auch in der nunmehr fünften, umfassend überarbeiteten Auflage blicken die Autor*innen auf die grundlegenden Aspekte der Politikwissenschaft und konzentrieren sich auf die politischen Systeme Deutschlands, Österreichs und der Schweiz, die sich stark unterscheiden und insofern interessante Vergleiche ermöglichen. Auch diese Auflage werde sich, so die Prognose Kolkmanns, zu einem „weit verbreiteten und oft genutzten Buch“, einem Vademekum entwickeln. (ste)
Michael Wolff: 77 Tage: Amerika am Abgrund: Das Ende von Trumps Amtszeit
Michael Wolff bereitet auf der Basis der letzten 77 (Amts-)Tage Trumps die Vorgeschichte des Sturms auf das US-Kapitol, auch anhand von Insider-Berichten, auf. All dies berührt für Michael Kolkmann im Kern auch die Frage, inwiefern eine politisch unerfahrene, kontroverse Person wie Donald Trump das Amt der US-amerikanischen Präsidentschaft veränderte? Und inwieweit er in seinem Handeln von den Grenzen der Amtsausübung beeinflusst wurde? Unser Rezensent empfiehlt daher das Buch ergänzend zur aktuellen US-Berichterstattung zu den noch andauernden Untersuchungen.
Marie-Luise Recker: Parlamentarismus in der Bewährung. Der Deutsche Bundestag 1949-2000
Unter dem Titel „Parlamentarismus in der Bewährung“ legt die Historikerin Marie-Luise Recker eine Studie über den Deutschen Bundestag vor, in dem sie den Wandel des Parlaments im Zeitraum zwischen 1949 und 2000 aufzeigt, problemorientiert zentrale Aspekte der Arbeit des Bundestages herausgreift und anhand zahlreicher Beispiele illustriert, so Rezensent Michael Kolkmann. Er schreibt, dass „dieser Band einen frischen sowie aktuellen, aber auch jederzeit geschichtswissenschaftlich fundierten Einblick in die parlamentarische Praxis der Bundesrepublik Deutschland“ erlaubt.
Sebastian Bukow / Uwe Jun / Jörg Siegmund (Hrsg.): Parteien in Bewegung
In diesem von Sebastian Bukow, Uwe Jun und Jörg Siegmund edierten Band stehe die Interaktion zwischen gesellschaftlichen Bewegungen und politischen Parteien im Blickpunkt. Das Erstarken der Bewegungen habe zwar zu „einem Partizipationsschub geführt“, aber auch dazu beigetragen, „die gesellschaftliche Verankerung der (etablierten) Parteien weiter erodieren zu lassen, auf die sich die Legitimität der repräsentativen Demokratie maßgeblich stützt.“ Thematisiert werde, so Rezensent Michael Kolkmann, wie Parteien auf den Veränderungsdruck reagierten. Dabei richte sich der Blick über die Bundesrepublik hinaus auch auf europäische Beispiele, wie etwa „La République en Marche!“
Florian Grotz / Wolfgang Schroeder: Das politische System der Bundesrepublik Deutschland. Eine Einführung
Mit ihrer neuen Einführung haben Florian Grotz und Wolfgang Schroeder aus Sicht von Rezensent Michael Kolkmann einen „unverzichtbaren Begleiter“ für alle vorgelegt, die sich mit dem politischen System der Bundesrepublik befassen. Dank eines umfangreichen Literaturverzeichnisses sei nicht nur ein profundes Nachschlagewerk entstanden, vielmehr setze das Buch auch Akzente, die es von ähnlichen Einführungen abgrenzten: Hier sind u. a. ein konsistenter Analyserahmen, eine institutionen- und akteursbezogene Perspektive und die Diskussion einzelner Elemente vor dem Hintergrund eines politischen Mehrebenensystems zu nennen.
Stephan Lamby: Entscheidungstage. Hinter den Kulissen des Machtwechsels
Das Buch des Journalisten und Filmautors Stephan Lamby lässt den Bundestagswahlkampf 2021 nochmals Revue passieren, schreibt Rezensent Michael Kolkmann. Denn Lamby habe die ihn prägenden Personen Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz über viele Monate begleitet. So sei "ein eindringliches Bild deutscher Politik im Ausnahmemodus?“ entstanden. Lamby thematisiere auch längerfristige Tendenzen deutscher Politik, sodass er mit "Entscheidungstage?“ insgesamt "eine Studie über die Bestimmungsfaktoren bundesdeutscher Politik im 21. Jahrhundert?“ vorgelegt habe.
Markus Ludwigs / Stefanie Schmahl (Hrsg.): 30 Jahre Deutsche Einheit
„Wir sind ‚noch längst nicht so weit, wie wir sein sollten. Aber zugleich sind wir viel weiter, als wir denken‘“. Diese Aussage des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier im Herbst 2020 diene als übergeordnetes Motto des von Markus Ludwigs und Stefanie Schmahl edierten Themenheftes, so Rezensent Michael Kolkmann. Letzterer hält die Publikation für ein „wichtiges Kompendium wissenschaftlicher Perspektiven auf das Erbe von 30 Jahren deutsch-deutscher Transformationsgeschichte“. Innerdeutsche Angleichungsprozesse sowie fortbestehende Divergenzen in vielen Bereichen werden analysiert und diskutiert.
Brigitte Grande / Edgar Grande / Udo Hahn (Hrsg.): Zivilgesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland. Aufbrüche, Umbrüche, Ausblicke
Ein neues Zentrum am WZB widmet sich der Erforschung der Zivilgesellschaft. Mit dem gemeinsam mit der Evangelischen Akademie Tutzing vorgelegten Sammelband ist ihm nach Meinung unseres Rezensenten Michael Kolkmann ein „beachtlicher Einstieg“ gelungen. Indem die Aufsätze auf historische Wendepunkte für die Entwicklung der bundesdeutschen Bürgergesellschaft eingehen, unterschiedliche soziale Bewegungen und Akteure in den Blick nehmen und neue Herausforderungen durch die Corona-Pandemie thematisieren, gelingt es ihnen aus Kolkmanns Sicht, die Bandbreite des Begriffs „Zivilgesellschaft“ aufzuzeigen.
Von „America First“ zu „Problems First“? Die Biden-Administration – eine erste Bilanz nach 100 Tagen

Michael Kolkmann bilanziert die Arbeit des 46. US-Präsidenten Joe Biden in den ersten drei Monaten nach seiner Wahl. Dabei geht er zunächst auf die besonderen Bedingungen zum Zeitpunkt der Amtsübernahme ein, blickt auf zentrale personelle Weichenstellungen und stellt die politische Agenda Bidens dar. Insgesamt habe der Präsident in einer erheblichen Geschwindigkeit ein „profiliertes“ politisches Programm umgesetzt. Kolkmann resümiert, dass mit Biden im Amt des Präsidenten „eine geordnete Regierungsmaschinerie“ und damit einhergehend eine „größere Verlässlichkeit“ zurückgekehrt sei.
Geert Mak: Große Erwartungen. Auf den Spuren des europäischen Traums (1999-2019)
Der bekannte niederländische Autor Geert Mak berichtet von seinen Reisen durch Europa. Dabei geht er der Frage nach, was seit 1999 in Europa passiert ist: „Was ist beim turbulenten Start ins 21. Jahrhundert mit der europäischen Welt geschehen?“ Damals sei der Kontinent voller Optimismus gewesen, doch mit dem 11. September 2001 und den folgenden Anschlägen in Madrid, London und Paris sei die europäische Welt ins Wanken geraten. Mak stellt die großen politischen Themen der vergangenen zwanzig Jahre dar und verbindet dabei persönliche Erfahrungen und Begegnungen mit politischen Trends.
Martin Florack / Karl-Rudolf Korte / Julia Schwanholz (Hrsg.): Coronakratie. Demokratisches Regieren in Ausnahmezeiten
Wie belastbar sind Demokratien in Ausnahmezeiten? So lautet die zentrale Frage dieses Sammelbandes, in dem eine Zwischenbilanz der bisherigen deutschen Corona-Politik gezogen wird und der „Reaktionen von Politik und Gesellschaft aus verschiedenen Perspektiven illustriert“. Die Pandemie stelle eine besondere Herausforderung für die Demokratie dar, so Rezensent Michael Kolkmann. Doch die Zwischenbilanz könne uns optimistisch stimmen, halten die Herausgeber fest: Für die Bundesrepublik habe sich bisher gezeigt, „wie resilient und stabil“ unsere Demokratie in der Krise geblieben sei.
Elmar Theveßen: Die Zerstörung Amerikas. Wie Donald Trump sein Land und die Welt für immer verändert
„Wie hat die Präsidentschaft von Donald Trump Amerika, die Amerikaner und die Position ihres Landes in der Welt verändert?“, lautet eine der zentralen Fragen Elmar Theveßens, des Leiters des ZDF-Studios in Washington. Die Folgen der Trump-Präsidentschaft, unabhängig davon, ob sie vier oder acht Jahre dauern werde, seien mit dem Ausscheiden Donald Trumps aus dem Weißen Haus nicht behoben, vielmehr werde diese Präsidentschaft, und mehr noch: die Art und Weise, wie Trump das Amt des Präsidenten interpretiert hat, amerikanische Politik für viele Jahre prägen.
Helmut Klages: Absturz der Parteiendemokratie? Die politische Lage in Deutschland
Da das Parteiensystem in Deutschland in den vergangenen Jahren deutlich polarisierter und fragmentierter geworden sei, sei es fraglich, so Rezensent Michael Kolkmann, ob der Begriff der Volkspartei noch gelte und ob politische Parteien ihre grundlegenden Funktionen noch erfüllen können. Der Soziologe und Verwaltungswissenschaftler Helmut Klages beschreibt wesentliche Entwicklungstendenzen des Parteiensystems und analysiert diese aus politikwissenschaftlicher Perspektive. Er identifiziert einen neuen Typ von Repräsentation und thematisiert Möglichkeiten zukünftiger Politikgestaltung.
Philipp Adorf: Die Republikanische Partei in den USA
Um den Erfolg Donald Trumps erklären und die Zukunft der Republikanischen Partei einschätzen zu können, geht Philipp Adorf in seiner Studie bis in die 1960er-Jahre zurück. Er beschreibt den Siegeszug der Partei im Süden der Vereinigten Staaten in dieser Zeit und identifiziert Trump und seine Politik als Konsequenz dieser Entwicklung. Die Wähler*innen, die Trump ins Amt gebracht haben, seien nicht der radikale Rand der Republikaner, sondern vielmehr ihr ideologisches Herz, so Adorf. Allerdings könne der demografische Wandel dazu führen, dass der Partei künftig ihre Wählerschaft ausgehe.
William Selinger: Parliamentarism. From Burke to Weber
William Selinger blickt auf die großen ideellen Wegbereiter des Parlamentarismus und spannt einen Bogen vom 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert. Dabei entwickelt sich die Abhandlung zu einer Art Geistesgeschichte liberaler politischer Ideen. Der am University College London lehrende Selinger führt die unterschiedlichen Denker unter einem Motiv zusammen: dem des Parlamentarismus. Wer sich mit den ideengeschichtlichen Aspekten des Parlamentarismus befassen möchte, der wird dieses Buch mit Gewinn lesen, schreibt Rezensent Michael Kolkmann.
Alexander Thiele: Der gefräßige Leviathan. Entstehung, Ausbreitung und Zukunft des modernen Staates
Alexander Thiele analysiert die verschiedenen Phasen der Entstehung des modernen Staates, benennt seine Merkmale und berichtet über dessen Ausbreitung in der Welt. Staatlichkeit habe sich schon immer im Wandel befunden, dieser sollte als Chance gesehen werden. Das, wie Rezensent Michael Kolkmann schreibt, lesenswerte Buch durchziehe die Überzeugung, „dass Staatlichkeit ein Werden, ein Verändern, kein bloßes Sein ist“. Es komme auf die Bürger*innen an, diesen Prozess in die gewünschte Richtung zu lenken. Thiele spricht sich für die Schaffung eines „denationalisierten demokratischen Verfassungsstaates“ aus.
Kristina Spohr: Wendezeit. Die Neuordnung der Welt nach 1989
Kristina Spohrs „Wendezeit“ steche laut Rezensent Michael Kolkmann aus der Fülle der Literatur zu den Ereignissen der Jahre 1989 insofern hervor als es eines der umfangreichsten Bücher zum Thema sei und auf einer einzigartigen Quellengrundlage basiere. Die Autorin benennt die politischen Akteure, die dafür gesorgt haben, dass der Transformationsprozess friedlich blieb und eine neue politische Ordnung errichtet werden konnte. Dabei bezieht sie auch die Grundlegung einer neuen internationalen politischen Ordnung zu Beginn der 1990er-Jahre mit ein.
Hans-Jörg Schmedes: Der Bundesrat in der Parteiendemokratie. Aufgabe, Struktur und Wirkung der Länderkammer im föderalen Gefüge
Hans-Jörg Schmedes widmet sich der Stellung des Bundesrates im politischen System der Bundesrepublik, seinen Aufgaben, Funktionen sowie seinem inneren politischen Prozess. Dabei fragt er, inwiefern die oftmals attestierte Blockade sowie Lähmung des politischen Prozesses durch die Länderkammer zutreffen. Seine empirischen Befunde zeigen hingegen, dass diese Annahmen nicht gültig sind. Tatsächlich stellen die konsensdemokratischen Praktiken sicher, dass ein Interessenausgleich erfolgt sowie vielfältige Erfahrungen und Fachwissen in die Gesetzgebung einfließen.
Philipp Adorf / Ursula Bitzegeio / Frank Decker (Hrsg.): Ausstieg, Souveränität, Isolation. Der Brexit und seine Folgen für die Zukunft Europas
Die Absicht der Herausgeber dieses Sammelbandes ist es, den Brexit aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten. Die Ursachen und Triebkräfte der Austrittsentscheidung werden noch einmal rekapituliert und als das Produkt mehrerer zusammenhängender und sich gegenseitig verstärkender Krisen dargestellt: „einer allgemeinen Vertrauenskrise der repräsentativen Institutionen in den westlichen Demokratien […], einer Krise des europäischen Integrationsprozesses und einer Krise des britischen Nationsverständnisses und Regierungsmodells“.
Wilbur C. Rich (Hrsg.): Looking Back on President Barack Obama’s Legacy. Hope and Change
Welche Spuren hinterlässt Barack Obama als 44. Präsident der USA? An welche Entscheidungen aus seiner Regierungszeit wird man sich eines zukünftigen Tages erinnern? Antworten auf diese Fragen liefern der Politikwissenschaftler Wilbur Rich und die Autor*innen des Bandes, die die Konturen der Obama-Präsidentschaft skizzieren. Dabei werden klassische Themen wie die Außen- oder Wirtschaftspolitik ebenso berücksichtigt wie Bereiche, die nach Ansicht des Rezensenten Michael Kolkmann eher selten im Fokus des politikwissenschaftlichen Interesses stehen – wie etwa die Rolle des Obersten Gerichtshofes oder die Arbeitsmarktpolitik.
Olivier Costa / Nathalie Brack: How the EU Really Works
Diese Einführung in das politische System der EU vereint eine Deskription europäischer Politik, die durch politikwissenschaftliche Zugänge ergänzt wird. Im Mittelpunkt stehen die Institutionen und der politische Entscheidungsprozess in der Union. Aber auch die Fragen, welche Rolle den nationalen Parlamenten zukommt und inwiefern nichtinstitutionelle Akteure in der europäischen Politik mitwirken, werden beantwortet. Entstanden ist so ein breit angelegtes Kompendium europäischer Politik, wie Michael Kolkmann schreibt.
Martin Pfafferott: Die ideale Minderheitsregierung. Zur Rationalität einer Regierungsform
Im Gegensatz etwa zu den skandinavischen Ländern, in denen Minderheitsregierungen gleichsam an der Tagesordnung sind, ist die politische Erfahrung mit dieser spezifischen Regierungsform in Deutschland überschaubar. Im Fachdiskurs gilt sie zumeist als instabil und irrational. Martin Pfafferott beansprucht mit seiner Dissertation, diese vermeintliche Irrationalität zu widerlegen. Anhand von drei Fallstudien untersucht er die Entstehungsbedingungen, Entscheidungsprozesse und Ergebnisse von Minderheitsregierungen, um hieraus die „ideale Minderheitsregierung“ charakterisieren zu können.