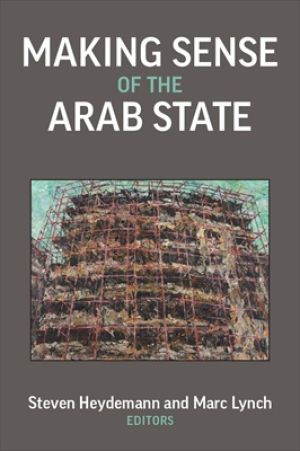Steven Heydemann & Marc Lynch (Hrsg.): Making Sense of the Arab State
Wie lässt sich der arabische Staat jenseits des gängigen „Failed-State“-Paradigmas verstehen? Viele Analysen stellen arabische Staaten pauschal als schwach, fragmentiert oder dysfunktional dar. Der Sammelband zeigt jedoch, dass diese Schwächen oft strategische, historisch gewachsene Elemente staatlicher Ordnung sind und Teil bewusst gesteuerter Mechanismen von Regimen. Laut unserem Rezensenten Sascha Ruppert-Karakas richtet sich der Band vor allem an Leser*innen mit Vorkenntnissen in politischer Theorie und der Geschichte der MENA-Region.
Eine Rezension von Sascha Ruppert-Karakas
Das Problem des Failed-State-Paradigmas im MENA-Raum
Im Zusammenhang des sogenannten Arabischen Frühlings wurde in vielen medialen Beiträgen eine Deutung sichtbar, in denen Staaten des arabischen Raums pauschal als Gebilde ohne Kontrolle, Recht und Ordnung beschrieben wurden. Zwar wurde immer wieder betont, dass die Aufstände seit 2010 eine Konsequenz gewaltsamer und kleptokratischer Herrschaftsstile der amtierenden Despoten seien. Zugleich dominierte jedoch ein ausschließlich politkulturelles Deutungsmuster, das die Fragmentierung des staatlichen Gewaltmonopols, die Abnahme administrativer Leistungsfähigkeit und die mangelhafte Bereitstellung öffentlicher Güter als langfristig determinierte Folgen einer vermeintlich grundlegend dysfunktionalen Staatslogik sowie einer archaischen politischen Mentalität interpretierte.[1]
Eine zentrale Analysekategorie dieser Sichtweise auf den arabischen Staat ist das seit längerem problematisierte Konzept des failed state.[2] Es versteht Staatlichkeit, wie im Nahen Osten, ausgehend von einem demokratietheoretisch normierten Idealbild, an dessen Ende die Entwicklung hin zu einem liberaldemokratischen Staat stehen sollte.[3] Unter der vermeintlichen Abwesenheit von Staatlichkeit wird hier meist ein Zustand beschrieben, der infolge kriegerischer Konflikte oder durch nicht intendierte Prozesse der Regierungsfragilität entstanden sei, etwa durch den Verlust politischer Legitimität, das Fehlen konsistenter Ordnungsmodelle oder asymmetrische Formen politischer Willensbildung. Dass bestimmte Gesellschaftssegmente oder Territorien nicht regiert werden, gilt in diesem Paradigma als Ausdruck misslungener Souveränität, nicht jedoch als Teil einer souveränen Strategie oder als bewusste Logik von Ordnungskonzepten. Offenbar wird mit diesen Annahmen vor allem eine neoweberistische und überwiegend westzentrierte Perspektive auf Staatlichkeit eingenommen,[4] die wissenschaftlichen Analysen verzerrt und gerade in der konkreten Frage um den potenziellen Zustand eines Regimes oft zu irreführenden Prognosen verleitet. Anstatt bloß Versagen zu diagnostizieren, sollte man sich die Frage stellen, ob es sich nicht um Eigenschaften und Mechanismen von Staatlichkeit handelt, die in ihrer eigenen Logik eine gewisse ordnungspolitische Funktionalität erfüllen.
Jenseits des Defizitmodells: Neue Kategorien arabischer Staatlichkeit
Der Sammelband „Making Sense of the Arab State“, herausgegeben von Steven Heydemann (Smith College) sowie Marc Lynch (George Washington University), setzt genau an diesem Punkt an und bricht bewusst mit dieser westlich geprägten Sichtweise auf den arabischen Staat. Ausgangspunkt ist die Absicht, politikwissenschaftliche Analysen aus der engen Perspektive auf Stateness, verstanden als die Kapazität „with which state institutions and actors deliver various forms of governance“ (2), zu lösen. Stattdessen wird ein alternativer Blickwinkel eingenommen, der die vermeintliche Abwesenheit staatlicher Eigenschaften nicht länger als Defizit beschreibt, sondern als positiv definierbare und historisch entwickelte Eigenschaft der jeweiligen politischen Ordnungen versteht. Damit soll die Betrachtung arabischer Staaten von einem irreführenden Vergleich mit westlichen Gegenstücken befreit werden, der sie allzu oft als Fälle konstruiert, die „lacks in comparison either to Western ideal types or to states in other postcolonial regions“ (2).
Das Defizitmodell charakterisiere Staaten in der arabischen Welt als „flawed, weak, fragile, and ineffective“ (3). Diese Zuschreibung spiegele jedoch in empirischen Analysen nicht die Realität wider und habe vielmehr dazu beigetragen, politische Bewertungen des staatlichen Zustands zu verzerren. Auf Grundlage einer Reihe empirischer Fallstudien versucht der Sammelband daher „beyond the deficit model to critically deploy foundational theoretical texts“ verschiedener politischer Theorien zu gelangen und eröffnet so neue Perspektiven auf die Analyse arabischer Staatlichkeit sowie auf das Process Tracing politischer Ergebnisse.
In der Einleitung definieren die Herausgeber die zentralen Kategorien, anhand derer die nachfolgenden Beiträge eine Neuverortung der Analyse arabischer Staatlichkeit vorantreiben sollen:
Erstens betonen sie die Zentralität von Regimen als maßgebliche Akteure. In arabischen Staaten richten diese ihre Kontrolle über den Staat, seine Kapazitäten und seine Entwicklungskonfigurationen vorrangig an der Sicherung des eigenen Überlebens aus. Entwicklungsprozesse sind folglich nicht als am Allgemeinwohl orientierte Zielsetzungen zu verstehen, sondern als Strategien einer Priorisierung von „survivalist preferences“ (4). Gerade diese Überlebenslogik wird als charakteristisch für arabische Regime hervorgehoben, da sie im Vergleich zu anderen Weltregionen eine Intensität erreicht, die deren staatliche Entwicklungspfade maßgeblich prägt.
Zweitens wird der Staat nicht länger als autonomer Akteur betrachtet, sondern als „expression of specific social actors“ (5). Diese Sichtweise schließt unmittelbar an die Betonung der Regimezentrierung an, weist jedoch zugleich eine foucaultsche Dimension auf. Die Herausgeber schlagen vor, „the uncertain boundary between state and society not as a problem for conceptual precision but rather as precisely the phenomenon to be explained“ (5) zu begreifen. Im Zentrum steht die Frage, inwiefern das Soziale „in and through the state“ wirkt und wie sich staatliche Ordnungen ihrerseits „as expressions of the social“ (5) manifestieren. Damit wird die Vorstellung neutraler Institutionen für die gewählten Fälle grundlegend in Frage gestellt.
Drittens heben sie die Variabilität der Staatspräsenz und die Bedeutung seiner Abwesenheit hervor. Staatliche Präsenz oder Absenz wird hier nicht primär als Defizit, sondern als Ergebnis bewusster politischer Steuerung verstanden. Entscheidend sind Prozesse einer „uneven societal legibility“ (6), die auf Aushandlungen spezifischer Elitenkoalitionen in postkolonialen Gesellschaftskonstellationen oder auf lokalspezifischen Arrangements zwischen Regimen und einflussreichen Akteuren beruhen. Dies kann „forms of stateness that are at times incommensurate with conventional notions of state sovereignty“ (7) hervorbringen.
Viertens wird die Frage nach der Staatsbürgerschaft neu akzentuiert. Prozesse staatlicher Inklusion und Exklusion sind in arabischen Staaten nicht an staatsbürgerliche Kriterien wie Freiheit und Gleichheit gebunden, sondern werden vielmehr „as a negotiated outcome dependent on a wide range of attributes, including sect, region, profession, ethnicity, or the perceived political or economic salience of a particular community for the security of a regime“ (7) gemanagt.
Vor diesem strategischen Zugang wird deutlich, weshalb die Beiträge auf eine Perspektivierung im Hinblick auf staatliche Legitimität verzichten. In der Tradition von Lisa Wedeens Überlegungen zur Ambivalenz politischer Ordnung wird die Messbarkeit von Legitimität vielmehr grundsätzlich in Frage gestellt.[5]
Das übergeordnete Ziel des Bandes liegt darin, ein Analyseraster für „den arabischen Staat“ zu entwickeln. Begründet wird dies mit einer Reihe geteilter historischer Pfade: den kolonialen Erfahrungen und der Herausbildung postkolonialer Gesellschafts- und Politiksettings, gemeinsamen Drucksituationen im Kontext des Kalten Krieges und der Unabhängigkeitsbewegungen, vergleichbaren Ressourcenlagen für die Entwicklung spezifischer politischer Ökonomien sowie ähnlichen internationalen und regionalen Einflussfaktoren. Nicht zuletzt verweisen die Herausgeber auf eine gemeinsame politische Kultur, die durch patriarchale Gesellschaftsstrukturen, stammesgebundene Formen sozialer Organisation sowie durch hierarchische, von einer Führungsfigur ausgehende Entscheidungsprozesse geprägt sei, die zwar relevant, jedoch nicht das ausschließliche Maß politischer Ordnungen im arabischen Raum darstellen (11–12). Die Herausgeber reflektieren zugleich kritisch, weshalb es überhaupt sinnvoll sein kann, von einem ‚arabischen Staat‘ als analytischer Kategorie zu sprechen. Ähnlichkeiten ergeben sich nicht aus einer essentialistischen arabischen Identität, sondern aus gemeinsamen historischen Entwicklungsverläufen, vergleichbaren externen Einflussfaktoren sowie bestimmten kulturellen und politischen Traditionen, die eine relative Vergleichbarkeit ermöglichen (11–12). Ziel ist es dabei ausdrücklich nicht, eine umfassende „grand theory of the Arab state“ vorzulegen, sondern vielmehr „to explore the relationship between regime behavior and state forms and to explain variations in state institutional capacity and other attributes of stateness“ (13).
Drei Dimensionen arabischer Staatlichkeit
Das Werk ist in drei größere Sektionen gegliedert, die jeweils das Zusammenspiel zwischen „dimensions of stateness, regime-ness, and state–society relations“ (14) sichtbar machen.
Die erste Sektion, Dimensions of Stateness, versammelt Beiträge von Steven Heydemann, Raymond Hinnebusch, Toby Dodge und Marc Lynch. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der „capacity, in particular questions about the relative weakness or strength of Arab states“, wobei die pauschale Klassifizierung arabischer Staaten „as either weak or strong“ ausdrücklich zurückgewiesen wird (15). Heydemann zeigt, wie Regime ihre Kapazitäten vor allem in sicherheitsrelevanten Sektoren im Sinne von Präferenzen um die Regimelanglebigkeit aufbauten. Hinnebusch beleuchtet die Entwicklung von Staatsmacht im langen Bogen postkolonialer Emanzipation und der Effekte neoliberaler Globalisierung. Dodge begreift Staatlichkeit als abhängige Variable von Elitenkonflikten in den Feldern Ökonomie, Militär und Politik. Lynch schließlich untersucht die Fähigkeit von Regimen ihre eigene Bevölkerung zu durchleuchten oder ‚lesbar‘ zu machen, und fragt nach den politischen Konsequenzen neuer Formen staatlicher Überwachung.
Die zweite Sektion, Dimensions of Regime-ness, mit Beiträgen von Bassel Salloukh, Lisa Anderson und Dipali Mukhopadhyay rückt die Regime in den Vordergrund „in the formation and transformation of state capacities and practices, as well as their effects on state–society relations and forms of social conflict“ (16). Salloukh analysiert den Libanon als Produkt sozialer Kämpfe einer oligarchischen Elite, deren Institutionen primär dazu dienen, den Status Quo so lang wie möglich aufrecht zu erhalten (16). Anderson zeichnet die Entwicklung der Golfstaaten hin zu einem leistungsorientiertes Governance-Modell nach, in dem das Verhältnis zwischen Regime und Bürger*innen auf Transaktionsgrundlagen der ökonomischen sowie politischen Nützlichkeit reduziert ist. Mukhopadhyay erweitert die Perspektive durch den Vergleichsfall Afghanistan, in dem Staatlichkeit, Staatsformen und staatliche Praktiken abhängige und instabile Variablen sind, deren Outcome von den dynamisch konstellierenden Elitenkoalitionen sowie der Interessanlage von involvierten externen Akteuren, insbesondere der USA ab 2001, bestimmt werden.
Die dritte Sektion, Contesting Stateness: Society and Sites of Resistance, fragt, „how practices of stateness are exercised, challenged, and transformed“ (18). Schwedler zeigt am Beispiel Jordaniens, dass Staatlichkeit ein aktiver Prozess der contestation ist, bei dem das Ausmaß gesellschaftlichen Widerstands darüber entscheidet, ob Regime Kapazitäten ausbauen und Souveränität durchsetzen. Yom illustriert diese Dynamik am Fall der Wasserpolitik, bei dem lokale Stämme staatliche Eingriffe als Verletzung historischer Abkommen zurückwiesen. Abgeschlossen wird die Sektion mit einer vergleichenden Analyse, die arabische Staatlichkeit in Beziehung zu südostasiatischen Formen von Staatlichkeit setzt und Gemeinsamkeiten wie Unterschiede herausarbeitet.
Vom generellen zum spezifischen: Ein konkreter Einblick in das Sammelband
Nach diesem generellen Überblick zur detailreichen Varianz des Sammelbandes sollen nun aus jeder der drei Sektionen einzelne Beiträge näher beleuchtet werden, die exemplarisch für die theoretische wie empirische Innovationskraft des Sammelbandes stehen und seine übergeordneten Fragestellungen konkretisieren.
Elitenkonflikte und die Fragmentierung des irakischen Staates
Besonders informativ ist in der ersten Sektion der Beitrag von Toby Dodge (“Rethinking the Postcolonial State in the Middle East: Elite Competition and Negotiation within the Disaggregated Iraqi State”). Aufbauend auf theoretischen Anregungen Pierre Bourdieus und Michael Manns begreift Dodge den irakischen Staat seit seiner Gründung als kompetitives Feld bürokratischer, politischer und ökonomischer Bereiche, die „have been ideologically reified to give the impression of a coherent, agential whole“ (86), in der Realität jedoch in abhängiger, zugleich aber eigenständiger Funktionsweise operieren. Seine zentrale These lautet, dass „actual coherence that exists between and within these competitive fields is gained through shifting balances of power between competing elites“ (86). Staatliche Kohärenz erscheint somit nicht als Ausdruck autonomer Institutionen, sondern als Kristallisationspunkt von Elitenkämpfen.
Diese Argumentation entfaltet Dodge anhand dreier knapp historisch rekonstruierter Abschnitte des modernen Irak. Während die Baath-Partei zwischen 1968 und 1980 einen mächtigen bürokratischen Apparat aufbaute, der im Revolutionary Command Council zum eigentlichen Zentrum politischer Entscheidungsgewalt wurde, führte Saddam Hussein diesen Prozess 1979 durch die Personalisierung aller Machtstrukturen zu einem Abschluss (93–94). In den 1980er Jahren verschob sich das Machtgefüge infolge des Kriegs gegen den Iran und später der internationalen Sanktionen nach dem Kuwaitkrieg zulasten des bürokratischen Apparats. Die Elite reduzierte ihre Verpflichtungen in allen zentralen Feldern und verlagerte Machtressourcen auf identitätsspezifische Gruppen, wodurch „each of the state’s major fields (economic, bureaucratic, coercive, and political) [was] strategically reduced“ (97).
Die bewusste Sektorisierung und identitätsspezifische Privilegierung durch Saddam Hussein (98–100) bereitete den Boden für ein informelles, jedoch stets kompetitives Konkordanzsystem, welches den Staat nach der US-Invasion ab 2003 prägte. Im ethnoreligiös verteilten Ämterproporz diente die Verwaltung nicht der Orientierung am Allgemeinwohl, sondern den Interessen konkurrierender Gruppen, die ihre Stellung im Staat auszuweiten suchten – ein Prozess, der sich exemplarisch in der Machtakkumulation schiitischer Bevölkerungsteile unter Nuri al-Maliki und dessen Konfrontation mit sunnitischen Gesellschaftssegmenten des Iraks zeigte (100–106).
Dodge gelingt es damit in beeindruckender empirischer Dichte zu zeigen, dass der Zerfall staatlicher Institutionen im Irak nicht als systeminhärenter oder sogar politikkultureller Determinismus zu verstehen ist, sondern als Resultat intentionaler Prozesse von Elitenkonflikten und Prioritätensetzungen im inneren sowie äußeren Überlebenskampf. Besonders aufschlussreich ist Dodge’ Analyse der 1990er Jahre, in denen der Irak unter den Sanktionen nicht in einen unkontrollierten Zerfall abglitt, sondern in eine selektive Reorganisation staatlicher Kapazitäten. Mit der Einführung eines landesweiten Rationierungssystems entstand „one of the most coherent institutions of state power“ (99), das zugleich soziale Kontrolle ermöglichte. Parallel dazu reaktivierte Saddam Hussein tribale Patronagenetzwerke (neo-tribalism), die gezielt Ressourcen verteilten und Loyalitäten sicherten. Diese Beispiele verdeutlichen, dass selbst der scheinbare Rückzug staatlicher Institutionen Ausdruck intentionaler Strategien war.
Hybride Souveränität und Elitenherrschaft im Libanon
Einen äußerst instruktiven Gegenpunkt zu Dodge liefert Bassel Salloukh in seinem Beitrag „What we Talk about when we talk about the State in Postwar Lebanon“. Aufbauend auf einer von Antonio Gramsci inspirierten Perspektive fragt er nach dem Wesen des libanesischen Staates und seiner Beziehung zu den im politischen System konstitutiven sektiererischen Subjektivitäten (142). Der besondere Wert dieser Analyse liegt darin, dass sie zeigt, wie „systematic corruption, the lack of accountability, [and] the predatory exploitation of public institutions“ nicht Ausdruck staatlicher Schwäche sind, sondern intentionale Ergebnisse eines mode of governance, der „served to reproduce sectarian modes of political mobilization, organization, and consent at the expense of alternative types“ (144).
Staatliche Souveränität erscheint in diesem Kontext als hybrides Modell (150), das unmittelbar aus dem Friedensprozess nach dem fünfzehnjährigen Bürgerkrieg hervorgegangen ist. Der Libanon wird als sektiererische Form der Interessensausgleichsdemokratie beschrieben, in der ethnisch-religiöse Eliten und ihre Netzwerke den Staat unter sich aufteilen und identitätsspezifische Antagonismen machtpolitisch ausnutzen. Nationale Kohäsion oder eine gemeinsame Zielsetzung des Staates existieren nicht, vielmehr definiert jede Gruppe diese nach eigenen identitären Maßstäben (153). Im Gegensatz zu Dodge, der den Irak als site of contestation zwischen rivalisierenden Gruppen versteht, begreift Salloukh den Libanon als „case of complete state capture by overlapping and inter-sectarian political, economic, and financial elites operating in unison and camouflaged as representatives of sects and protected from accountability by the technologies of consociational power sharing“ (156).
Das libanesische System wird damit weniger durch den antagonistischen Machtkampf zwischen Gruppen geprägt als durch die Stabilität fester Einflussbereiche, innerhalb derer Eliten ihre jeweiligen Anhängerschaften bedienen. Dieses mode of governance führt, so Salloukh, dazu, dass es „distorted the very incentives structuring political action; disaggregated class loyalties; delivered a measure of ideological consent; reproduced sectarian modes of political identification and mobilization; and operated to preclude alternative oppositional organizational forms and political alternatives to sectarianism“ (157). Es bleibt damit ein sektiererischer Bezugsrahmen für die Identifikation als Staatsbürger bestehen, die jedwede übergeordnete nationale Identität, die für eine gemeinsame sowie verbindende Handlung aller Staatsbürger nötig wird, unterbindet.
Gerade im Kontext systemischer Korruption, des ökonomischen Niedergangs oder katastrophaler Ereignisse wie der Explosion im Beiruter Hafen (156–162) zeigt sich die Tragweite dieser Logik. Sie verhindert, dass Verantwortung klar zugerechnet werden kann und schirmt die Eliten wirksam gegen Kritik aus den eigenen Bevölkerungsgruppen ab. Reformen werden dadurch nicht nur blockiert, sondern konzeptionell ausgeschlossen. Entscheidend für die Funktionsweise des libanesischen Staatsmodell ist dabei Salloukhs Rekurs auf das Bild des ‚integral state‘, dass die Trennung von Staat und Gesellschaft, privat und öffentlich, formal und informell aufhebt. Der libanesische Staat erscheint hier nicht als schwach oder hybrides Konstrukt, sondern als Produkt eines hegemonialen Herrschaftsprojekts, das auf Kapitalakkumulation, Klientelismus und die Reproduktion sektiererischer Subjektivitäten ausgerichtet ist. Anstatt also von einem Zerfall des Staates als Nebenprodukt gesellschaftlicher Kämpfe zu sprechen, macht Salloukh deutlich, dass es sich um ein bewusstes und statisches Arrangement handelt, in dem sich die Interaktion von Staat und Gesellschaft entlang sektiererischer Logiken organisiert und Staatsbürgerschaft als identitätsspezifische und damit ungleiche Kategorie reproduziert wird.
Selektive Staatlichkeit: Versorgungspolitik im Rahmen des Stammes-Staat-Pakts
Ein besonders anschauliches Beispiel für die Analyse von Staatlichkeit jenseits des Defizitparadigmas liefert Sean Yom in seinem Beitrag „Water, Stateness, and Tribalism in Jordan: The Case of the Disi Water Conveyance Project“. Ausgangspunkt ist das milliardenschwere Vorhaben zur Etablierung einer nationalen Wasserversorgung durch das Regime von Abdullah II. bin al-Hussein, das nicht realisiert werden konnte, weil Teile der jordanischen Beduinenstämme den Ausbau gezielt blockierten. Sie verstanden das Projekt als Eingriff in ihre partiellen Hoheitsrechte über bestimmte Territorien und zugleich als Ausdruck einer neoliberalen Vision des Königs, der sie sich verweigerten (269). Yom zeigt damit, dass Souveränität in arabischen Staaten auch bedeuten kann, dass „a repressive autocracy within an established stable, and sovereign state can cohabit the same space as social resistance that disrupts public order and that commands political significance despite not targeting the locus of state power or calling for revolution“ (249).
Zur Erklärung dieser Dynamik verweist Yom auf die historische Genese der jordanischen Monarchie seit dem britischen Mandat der 1920er Jahre. Die Etablierung haschemitischer Kontrolle beruhte von Beginn an auf einem Herrschaftsarrangement mit den Beduinenstämmen, die zwar partiell in das staatliche System integriert wurden, zugleich aber über eigene Hoheitsrechte in bestimmten Territorien verfügten. Diese Bereiche blieben faktisch dem staatlichen Zugriff entzogen (262–266). Vor diesem Hintergrund entschied die Regierung trotz vertraglicher Verpflichtungen gegenüber internationalen Gebern, den weiteren Ausbau des Disi-Projekts einzustellen.
Das vermeintliche Versagen des Staates erscheint in Yoms Analyse nicht als Ausdruck von Schwäche, sondern als Resultat eines rationalen Kosten-Nutzen-Kalküls, das das Regime zugunsten der eigenen Stabilität und der Wahrung historischer Vereinbarungen mit den Stämmen traf. Selektive Regierungsführung und Widerstand gegen staatliche Eingriffe sind somit kein Indikator eines nahenden Systemzusammenbruchs, sondern Ausdruck eines langfristigen Machtarrangements. Der Widerstand gegen das Wasserprojekt fungierte daher weniger als revolutionärer Akt, sondern vielmehr als Erinnerung an dieses ursprüngliche Agreement (270). Kritisch ließe sich indes anmerken, dass Yoms Betonung des rationalen Kalküls des Regimes den Blick auf strukturelle Schwächen verkürzt. Zwar zeigt seine Analyse überzeugend, dass selektiv und ungleichmäßige Staatlichkeit in Jordanien Ergebnis historischer Arrangements und bewusster Entscheidungen ist (264), doch bleibt offen, inwiefern das Regime tatsächlich Handlungsspielräume hatte oder durch die sozialen Machtressourcen der Stämme in seiner Souveränität faktisch begrenzt wurde.
Ein Band für Kennerinnen und Kenner
Der Sammelband ist ein detailreiches Werk, das nahtlos an Steven Heydemanns bereits 2013 herausgegebenes Standardwerk „Middle East Authoritarianisms: Governance, Contestation, and Regime Resilience in Syria and Iran“ anschließt und dieses zur umfänglichen Analyse der politischen Ordnungen in der MENA-Region sinnvoll ergänzt.[6] Trotz der zahlreichen instruktiven Fallbeispiele zeichnen sich die Beiträge durch eine stark variierende sprachliche Zugänglichkeit aus. Insbesondere die theoretische Fundierung der Fallanalysen in den ersten beiden Sektionen verlangt eine Vertrautheit mit politischer Theorie, die eher in höheren Semestern der Sozialwissenschaften zu erwarten ist. Hinzu kommt, dass die Vielfalt der Länderfälle sowie die Komplexität der politischen und historischen Konstellationen ein gewisses Vorwissen zur Region oder zumindest die Bereitschaft voraussetzen, sich begleitend weitere Informationen zu erschließen. Das Werk richtet sich daher vor allem an erfahrene Leserinnen und Leser sowie insbesondere Personen, die für eine wissenschaftliche Arbeit an einer analytischen Durchdringung politischer Prozesse in der MENA-Region interessiert sind.
Anmerkungen:
[1]Ohne Autor (13.06.2014): Hintergrund: «Failed States» - gescheiterte Staaten, in: Süddeutsche, online unter: https://www.sueddeutsche.de/politik/konflikte-hintergrund-failed-states-gescheiterte-staaten-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-140613-99-05750.
Hottinger, Arnold (05.12.2014): Bald nur noch Failed States?, in: Journal21, online unter: https://www.journal21.ch/artikel/bald-nur-noch-failed-states.
[2] Call, Charles (2008): The Fallacy of the ‘Failed State’, in: Third World Quarterly, Vol. 29, Issue 8, S. 1491-1507.
Call, Charles (2010): Beyond the ‘failed state’: Toward conceptual alternatives, in: European Journal of International Relations, Vol. 17, Issue 2, S. 303-326.
[3] Helman, Gerald/Ratner, Steven (1992): Saving Failed States, in: Foreign Policy, No. 89, S. 3-20.
[4] Bouckaert, Geert (2023): The neo-Weberian state: From ideal type model to reality?, in: Max Weber Studies, Volume 23, No. 1, S. 13-59.
[5] Wedeen, Lisa (2015): Ambiguities of Domination: Politics, Rhetoric, and Symbols, Chicago: Chicago University Press.
[6] Heydemann, Steven/Leenders, Reinoud (Hrsg.) (2013): Middle East Authoritarianisms: Governance, Contestation, and Regime Resilience in Syria and Iran, Stanford: Standford University Press.