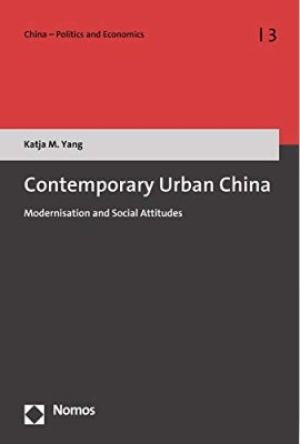Katja M. Yang: Contemporary Urban China. Modernisation and Social Attitudes
Wieso haben Wohlstand, Urbanisierung und Bildungsexpansion in China nicht zu Forderungen nach mehr politischer Mitsprache der Bürger*innen geführt? Mit dieser Frage befasst sich Katja M. Yang. Nach Meinung unseres Rezensenten Rainer Lisowski gelingt es ihr, die Synthese zwischen den vermeintlichen Widersprüchen zwischen dem Segen und dem Fluch der Modernisierung für den einzelnen Menschen aufzubereiten. Ihre These laute: Es gebe zwei Bilder von China: das der funktionalistischen und das der gespaltenen Gesellschaft. Beide neigten dazu, die Menschen von politischer Mitsprache abzuhalten.
Das zeitgenössische urbane China. Modernisierung und soziale Einstellungen
‚Demokratie? Die sind noch nicht so weit.‘ – So in etwa könnte ein typischer Kommentar lauten, der sich mit der Frage von Demokratisierungsprozessen in sich entwickelnden Ländern befasst. Und tatsächlich läuft der wesentliche Strang politischer Modernisierungstheorien darauf hinaus, einen Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und politischer Form zu postulieren. Im Literaturfundus weit zurückgeblickt, wären wir damit etwa bei Karl Marx und seiner Theorie zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und ‚politischem Überbau‘ (wobei Marx natürlich die westlichen Demokratiemodelle nur als eine Zwischenstufe zum – seiner irrigen Meinung nach – finalen Kommunismus ansah). Elaborierter und empirisch besser unterfüttert wäre etwa der Ansatz von Seymour Martin Lipset, der vor sechs Jahrzehnten in seinem bekannten Standardwerk Political Man auf den Zusammenhang zwischen Wohlstand, Bildung und Urbanität einerseits und Demokratie andererseits hinwies. Neuere Forschungen, zum Beispiel von Daron Acemoğlu und James A. Robinson (Why Nations fail), deuten in eine ähnliche Richtung. Hier wird der Fokus aber eher auf die Frage gelegt, ob es einer Gesellschaft gelungen ist, (demokratisch) stabilisierende, weil inkludierende, Institutionen zu schaffen.
Eher verworfen werden heute Thesen, die Demokratisierung oder staatliche Stabilität über externe Effekte wie das Klima oder schwer zu erfassende Konstrukte wie Kultur ableiten.
Doch was ist mit Ländern, bei denen etliche der angedeuteten Punkte wie ein steigender Bildungsgrad oder wachsender Wohlstand für eine Demokratie sprechen würden, bei denen sich aber keine solche zu entwickeln scheint? Insbesondere: China. Dem geschichtsmächtigen Land ist es seit der Öffnung durch Deng Xiaoping gelungen, von einem armen Staat zu einem ‚Middle Income Country‘ zu werden. Dennoch fand keine Demokratisierung statt. Einiges spräche dafür. Indikatoren wie der Gini-Koeffizient deuten derzeit zwar in Richtung einer stärkeren Ungleichheit in China, jedoch auf ungleich höherem Niveau als früher. Unter Mao waren die Menschen gleich und arm. Heute sind sie deutlich wohlhabender, wenngleich der Wohlstand ungleicher verteilt ist als früher. Doch obwohl die meisten Chinesen heute über eine höhere Kaufkraft verfügen, ist keine Demokratisierung feststellbar. Dabei hat sich das immer schon ländlich geprägte China zudem in demselben Zeitraum rasant urbanisiert. Auch hier würden Standardtheorien vermuten lassen, das die (reich gewordenen) Städte mehr politische Mitsprache verlangten – jedoch: nicht beobachtbar. Zwar haben vielmehr Menschen in China heute Zugang zu besserer Bildung. Doch auch mehr Bildung scheint hier keinen Demokratisierungsschub auszulösen. Woran liegt es also im Falle Chinas, dass eine Demokratisierung ausbleibt?
Mit dieser Frage befasst sich Katja M. Yang in ihrer Dissertation. Wieso haben größerer Wohlstand, veränderte Werte, stärkere Urbanisierung und mehr Bildung – sie zeichnet in den ersten Kapiteln alle diese Entwicklungen gut nach – nicht zu lauteren Forderungen nach politischer Mitsprache geführt?
Kurzer Einschub: Manche werden sofort die unterdrückende Rolle der Kommunistischen Partei Chinas als Begründung anführen. Doch nach allem was wir wissen, wäre dieses Bild nicht vollumfänglich zutreffend. Denn selbstverständlich gibt es staatliche Kontrolle in China, sie fällt nur in der Regel ‚sanfter‘ aus als dies in westlichen Medien mit der Fokussierung auf Konfliktfälle wie etwa Xinjiang zumeist diskutiert wird. David Mattingly hat diese eiserne Faust in Samthandschuhen in The Art of Political Control in China vor zwei Jahren hervorragend beschrieben. An dieser Stelle sei eine kleine Kritik an dem ansonsten hervorragend gelungenen Text von Yang erlaubt: Eigentlich hätte sich ihre Arbeit etwas ausführlicher gerade mit diesem Argument der Demokratieunterdrückung durch die Diktatur der Partei beschäftigen sollen.
Doch zurück zu Yangs Forschungsvorhaben und seiner technischen Seite. Nachdem sie den Zusammenhang zwischen sozialem Wandel und politischer Transformation auf theoretischer Ebene nachgezeichnet hat und dabei niemals den Seitenblick auf China außer Acht lässt, beschreibt sie im dritten Kapitel ihr eigenes Vorgehen (Forschungsfrage und allgemeines Studiendesign waren schon zuvor in Kapitel 2.5. vorgestellt worden). Grundsätzlich nähert sich Yang dem Thema von der Prämisse, dass die Wahrnehmung über die eigene Rolle und Position in einer Gesellschaft wesentlich dazu beiträgt, ein politisches Bewusstsein zu entwickeln, das die Grundbedingung für die Forderung nach politischer Partizipation ist. Dafür bedarf es wiederum eines Sets von politischen Einstellungen. Vor allem, dass man über Möglichkeiten verfügt, Politik zu beeinflussen – wie klein diese Möglichkeit auch erst einmal sein mag. Diese grundsätzlichen Haltungen stellt sie eingangs vor (63 ff.). Und es folgen, wie für eine Dissertationsschrift üblich, Ausführungen zum methodologischen Grunddesign (hier: Grounded Theory, politisch-linguistische Analyse von Aussagen ihrer Interviewpartner) und der Erhebungsform. Interviewt wurden etwa 100 Personen in drei Städten/Regionen: Beijing, Xi‘an und Wenzhou. Die Tiefeninterviews fanden auf Chinesisch statt. Sie wurden – state of the art – vollständig transkribiert und mit einem hermeneutischen Interpretationssystem ausgewertet.
Die ausführliche Darstellung beginnt mit den hochinteressanten Interviewsequenzen (93). Die Präsentation, Strukturierung und Interpretation des mühsam zusammengetragenen und ausgewerteten empirischen Materials macht den Hauptteil des Buches aus. Der Autorin gelingt es dabei, schon während der laufenden Argumentation, die Synthese zwischen den vermeintlichen Widersprüchen – dem Segen und dem Fluch der Modernisierung für den einzelnen Menschen – auf- und vorzubereiten. Yang schlägt bei ihrer Darstellung immer wieder den Bogen von lebenspraktischen Erfahrungen ihrer Interviewpartner*innen zu deren politischem Bewusstsein. Stück für Stück wird aus dem Mosaik ein Bild deutlich: Es zeichnet ein ‚Sowohl-als-auch‘ ab. Einerseits nimmt die Mehrzahl ihrer Gesprächspartner*innen Chinas Aufbruch in die Moderne als einen Gewinn für das eigene Leben und eine Verbesserung der eigenen Lebensposition (oder zumindest der Chancen) wahr – beispielsweise bei der Bildung, den Freizeitangeboten, dem angebotenen Wohnraum oder den Konsummöglichkeiten. Gleichzeitig gibt es aber an eben diesen Stellen eine Menge von Unsicherheiten in der chinesischen Gesellschaft, die für die meisten die Aussichten sofort auch wieder eintrüben, wie etwa explodierende Wohnungspreise oder die wahrgenommene Bildungsinflation. Als zweischneidiges Schwert erweist sich also der Modernisierungsprozess und es scheint die unglaubliche Wucht der wirtschaftlichen Dynamik und ihrer Geschwindigkeit zu sein, die einerseits viele Menschen rasch nach oben reißt, die ihnen aber zugleich das Gefühl vermittelt, sozial stets verwundbar zu sein. Viel ist in den Interviews von Unsicherheit die Rede (107). Und genau dies wirkt sich nach Einschätzung von Yang tiefgreifend auf politische Einstellungen aus.
Von besonderem Interesse ist vor allem das finale, neunte Kapitel der Arbeit, in dem sie auf der Grundlage des qualitativen Materials einen eigenen Theorieansatz generiert, der helfen soll, die ausbleibende Demokratisierung Chinas in der Moderne zu erklären. Yangs Argumentation verläuft in etwa folgendermaßen:
Sie glaubt, es gäbe in den Köpfen der Menschen zwei Bilder von China: das der funktionalistischen und der gespaltenen Gesellschaft. Der besondere Clou: Beide, so Yang, neigten durch ihre jeweilige Ausprägung dazu, die Menschen von politischer Mitsprache abzuhalten.
Wer China als gespalten betrachtet, steht oft eher auf der Seite der Modernisierungsverlierer oder zumindest derjenigen, deren Lage besonders labil zu sein scheint. Hier nimmt man das Land vor allem deshalb als gespalten wahr, weil sich – so das Narrativ – eine kleine, mächtige politisch-wirtschaftliche Funktionärselite der Ressourcen bemächtigt habe und weiterhin die Mehrheit der Menschen von diesen ausschließe. Sich selbst empfindet man als dermaßen ohnmächtig, dass die Idee eines Aufbegehrens in Form von politischer Partizipation gar nicht erst entsteht. In Yangs Sample werden etwa 20 Prozent dieser Position zugeordnet.
Die funktionalistische Sicht ist in dem Sample deutlich öfter verbreitet und nimmt China als sozial komplexer stratifiziert wahr – mit Ober- und Unterschicht und einer breiteren Mittelschicht, die ihrerseits auch wieder unterteilt werden kann. Dieser Teil der Gesellschaft äußert sich in den Interviews zwar selbstbewusst und selbstbestimmt. Aber! Dies bezieht sich ausschließlich auf die Wirtschaftsbürger*innen. Die Idee des Citoyens wird abgespalten und hier zeigt man sich im Gegenteil nicht selbstsicher. Vielmehr deuten die Argumentationsmuster der Interviewten an, dass man die Ressourcen des Landes als begrenzt wahrnimmt und deren Verteilung als Aufgabe einer politischen Elite, ja, einer weisen politischen Kaste angesehen wird, die im Grunde dafür bestimmt sei, das Land zu regieren (266-274).
Überspitzt sind wir am Ende so doch wieder bei Marx gelandet: Ohne das Bewusstsein für die eigene Position (hier: als Bürger*in, nicht als Mitglied der Arbeiterklasse) wird das nichts mit der – hier bürgerlichen – Revolution.
Damit wären wir bei einem zweiten kleinen Kritikpunkt bezüglich dieses Buches. Denn eigentlich sind die Thesen – wenn man sie gedanklich ein wenig dreht und wendet – insgesamt nicht gänzlich unbekannt. Der funktionalistische Gedanke ist insgesamt doch recht gut an die alte Idee des ‚Mandats des Himmels‘ anschlussfähig: Sollen die regieren, die die Vorsehung dafür bestimmt hat. Dennoch ist Katja Yang eine interessante und aussagestarke Studie gelungen, die sich hoffentlich zahlreicher Leser*innen erfreuen wird. Zumal Yang sich am Ende nicht davor scheut, eine Festlegung zu riskieren. Sie sagt voraus: Auf absehbare Zeit werde China sich nicht demokratisieren. Und zwar weniger, weil das Volk unterdrückt werde, sondern vielmehr, weil hierfür aus unterschiedlichen Gründen kein brennender Bedarf zu bestehen scheine.
So denn: Vielleicht geht irgendwann einmal ein ‚Gespenst‘ um in China. Derzeit wäre mit einer Sichtung desselben aber eher nicht zu rechnen.
Rezension / Rainer Lisowski / 01.10.2020
Zak Dychtwald: Young China. Wie eine neue chinesische Generation ihr Land und die ganze Welt verändert
So alt diese Führungsspitze der Volksrepublik auf manche wirken mag, so jung ist doch das Land. Von den etwa 1,3 Milliarden Menschen sind 400 Millionen in oder nach dem Jahr 1990 geboren. Chinas Millennials sind zusammen genommen fünfmal größer als die Einwohner der Bundesrepublik. Dieses Land, nein diesen Kontinent zu erkunden, hat sich Zak Dychtwald zur Aufgabe gemacht.
Rezension / Rainer Lisowski / 20.06.2020
Daniel C. Mattingly: The Art of Political Control in China
Zensur der Medien, Verbote religiöser Praktiken, Verhaftung von Dissidenten, brutale Polizeigewalt gegen Proteste. So in etwa schaut auch das in den Medien gezeichnete Bild von China im Westen aus. Doch neben dieser stählernen Faust gelingt die Überwachung der chinesischen Gesellschaft durch den Staat möglicherweise noch auf andere Weise, nämlich schleichend, beinahe wie auf Samtpfoten, wenngleich auch diese Krallen haben. Um diese Form informeller Kontrolle geht es in der hervorragenden Analyse „The Art of Political Control in China“ von Daniel Mattingly.
Rezension / Dirk Burmester / 08.05.2013
Daron Acemoglu / James A. Robinson: Warum Nationen scheitern. Die Ursprünge von Macht, Wohlstand und Armut
Trotz der umfänglichen Literatur zu Aufstieg und Absturz von Gesellschaften interpretieren Daron Acemoglu und James Robinson die Wirtschaftsgeschichte noch einmal neu, denn ihrer Ansicht nach reichen die Theorien zu kulturellen Einflüssen oder geografischen Faktoren nicht aus, um einzelne Entwicklungen zu erklären. Die beiden Ökonomen (MIT und Harvard) stellen die politischen Institutionen in den Mittelpunkt, die wiederum bestimmen, welche wirtschaftlichen Institutionen eine Gesellschaft hat.
Externe Veröffentlichungen
Heiko Herold / 25.06.2021
Konrad-Adenauer-Stiftung
Micha Brumlik / 01.10.2020
Blätter für deutsche und internationale Politik