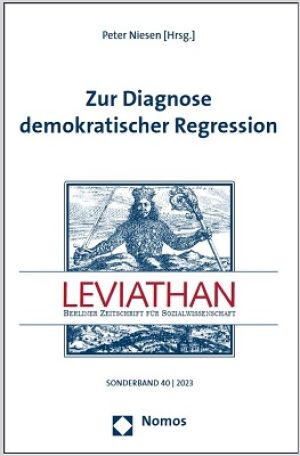Peter Niesen (Hrsg.): Zur Diagnose demokratischer Regression
Der Sammelband nimmt die vielbeachtete Studie von Armin Schäfer und Michael Zürn zum Anlass, die von ihnen vorgestellte These der „demokratischen Regression“ und die darin enthaltenen empirischen Beobachtungen und methodischen Herangehensweisen kritisch zu diskutieren und weiterzuentwickeln. Herausgekommen ist für David Kirchner ein zugleich innovatives und inhaltlich kohärentes Buch. Insbesondere die methodische Diskussion um die Gebundenheit von Demokratieindizes an politische Paradigmen verweise dabei auf die Notwendigkeit einer „Demokratisierung der Demokratieforschung“.
Eine Rezension von David Kirchner
„Nun sag', wie hast du's mit der Regression?“ So ließe sich die Gretchenfrage auf den Punkt bringen, die Herausgeber Peter Niesen den Autor*innen des Leviathan-Sonderbandes „Zur Diagnose demokratischer Regression“ stellt. Der Begriff der demokratischen Regression verweist auf den gemeinsamen Ausgangspunkt der Beiträge, nämlich das 2021 erschienene gleichnamige Buch von Armin Schäfer und Michael Zürn. Darin bestimmten die beiden Politikwissenschaftler die demokratische Regression als Ausdruck einer doppelten Entfremdung: Zum einen sei da die Verringerung der institutionellen Qualität von Demokratien, weil sich die „demokratische Praxis zunehmend vom Ideal der kollektiven Selbstbestimmung“ entferne (Schäfer/Zürn 2021: 11). Zum anderen bedeute demokratische Regression aber auch eine Abwendung der Bürger*innen von demokratischen Prozessen, weil sie sich in diesen nicht mehr angemessen vertreten fühlten.
Auf der kausalen Ebene erklärten Schäfer/Zürn die Regression und den damit verbundenen Aufstieg des autoritären Populismus als Ergebnis zweier Prozesse: Erstens sei das zentrale demokratische Prinzip, das Versprechen der politischen Gleichheit, in den liberalen Demokratien beschädigt, was sich in der „selektiven Responsivität der gesetzgebenden Parlamente“ zeige (ebd.: 91). Die Interessen der unteren Klassen blieben in den Hohen Häusern demnach strukturell un(ter)berücksichtigt. Zweitens hätten demokratisch legitimierte Institutionen wie Parlamente und Parteien im Zuge des neoliberalen Siegeszugs an Bedeutung verloren, weil Entscheidungsbefugnisse zu nichtmajoritären Institutionen wie Zentralbanken, Verfassungsgerichten und internationalen Organisationen transferiert worden seien (ebd.: 18).
So unterschiedlich die im Band versammelten Perspektiven auch sind, sie alle teilen die Einsicht, dass es sich bei der demokratischen Regression um einen in gleich mehrfacher Hinsicht umstrittenen und höchst voraussetzungsreichen Begriff handelt: Aus Sicht der Vergleichenden Politikwissenschaft, weil das Sprechen von der Regression nach einer empirisch robusten Fundierung verlange, die über die assoziative Benennung einzelner Episoden hinausgeht (12). Aus Sicht der Politischen Theorie, weil die Frage nach dem Demokratieverständnis für jede Regressionsdiagnose von zentraler Bedeutung sei. Und schließlich aus Sicht der Politischen Philosophie, weil die Regression als Komplementärbegriff zum Fortschritt „Einiges an geschichtsphilosophischen Ballast und nicht zuletzt psychoanalytischem Vorverständnis“ (22) im Gepäck habe.
Die Beiträge des Bandes sind in vier Kapitel gegliedert, die sich mit den Merkmalen der demokratischen Regression, ihrer Politischen Theorie, dem Verhältnis von Regression und Fortschritt sowie der Konstitutionalisierung und Pluralisierung von Demokratie beschäftigen. Im Folgenden sollen die im Band versammelten Argumente jedoch nicht chronologisch, sondern problemzentriert anhand der drei aus meiner Sicht zentralen Problemkonstellationen vorgestellt werden.
Zur Diagnose der demokratischen Regression
Die erste und breiteste der Problemkonstellationen betrifft die Diagnose der demokratischen Regression selbst, die in den Beiträgen sowohl theoretisch als auch empirisch verteidigt und angegriffen, erweitert und spezifiziert sowie zurückverfolgt und weitergedacht wird. Als Startpunkt dieser Rezension soll der Beitrag von Schäfer dienen, der in Reaktion auf eine Kritik von Niesen (2021) den in der Ausgangsdiagnose verwendeten Regressionsbegriff theoretisch verteidigt und neorepublikanisch als „Ideal des Nicht-Beherrschtwerdens“ (32) präzisiert.
Empirisch unterstreicht er anhand deskriptiver Statistiken zur politischen Partizipation und zur Repräsentation sozialer Klassen im Bundestag, dass dieses Ideal und mit ihm das Versprechen politischer Gleichheit in Deutschland uneingelöst bleibe, solange ärmere und weniger gebildete Menschen nicht die gleiche Chance hätten, politische Entscheidungen zu beeinflussen. Schäfers Verteidigung überzeugt theoretisch und größtenteils auch empirisch. Angesichts seiner Konzeption der Regression als der Entfernung von einem Ideal überrascht es allerdings etwas, dass sich die präsentierte Evidenz nicht stärker auf die zeitliche Entwicklung der politischen Ungleichheit fokussiert.
Die Beiträge von Jonathan White, Claudia Landwehr sowie Svenja Ahlhaus und Markus Patberg unternehmen Versuche, das Verständnis von Regression theoretisch zu erweitern. Während White die demokratische Regression als Ergebnis eines verhängnisvollen Wechselspiels erklärt, indem er darauf hinweist, dass der autoritäre Populismus eine direkte Antwort auf die Verleugnung politischer Handlungsfähigkeit durch politische Eliten sei, betont Landwehr den psychoanalytischen Gehalt der Regression, die aus einer Abwehrreaktion gegen Kränkungen und Überforderungen entstehe und „einen Rückfall […] hinter bereits entwickelte zivilisatorische Leistungen“ (165) darstelle. Im Falle der Demokratie sei diese Leistung die Etablierung von Verfahren gewesen, deren Ergebnisse von den Bürger*innen als legitim anerkannt wurden. Dass dieser Verfahrenskonsens in vielen Demokratien zunehmend bröckele, ist für Landwehr Ausdruck von Regression. Da aber nicht jede Infragestellung etablierter Verfahren zwangsläufig regressiv sein müsse, plädiert sie am Ende ihres Beitrags für eine Diskussion über die Unzulänglichkeiten existierender Institutionen.
Dagegen unternehmen Svenja Ahlhaus und Markus Patberg den Versuch, die Kategorie der Regression auf überstaatliche Prozesse anzuwenden. Hierzu fragen sie, welche normativen Anforderungen an Austritte von Staaten aus internationalen Institutionen zu stellen seien (170). „Der Brexit ist legitim, weil das Volk so entschieden hat“ sei demnach eine problematische Sicht, weil sie verkenne, was durch den Austritt an normativen Errungenschaften verloren gehe. „Souveräner Voluntarismus“ beginne schon dort, wo die Vorstellung herrsche, dass Staaten frei über ihre Mitgliedschaft entscheiden dürften (187). Auch wenn Ahlhaus und Patberg betonen, dass Austritte möglich bleiben müssen, sind ihre Anforderungen daran so hoch, dass sie die Integration in die liberale internationale Ordnung de facto zur automatischen Voreinstellung erklären. Die Begründungspflicht liegt damit beim „demokratischen Souverän“, der sich entschieden hat zu gehen, nicht bei den supranationalen Institutionen mit den berüchtigten „demokratischen Defiziten“.
Eine wichtige empirische und konzeptionelle Relativierung der Regressionsdiagnose von Schäfer/Zürn leisten die Beiträge von Stefan Voigt sowie von Jasmin Sarah König und Tilko Swalve. Letztere zeigen auf Basis quantitativer Daten, dass kein klarer Zusammenhang zwischen populistischen Regierungen und konstitutioneller Regression, also der Unterminierung liberaldemokratischer Institutionen durch Verfassungsänderungen besteht. Dies widerspricht der Annahme, dass mit Exekutivmacht ausgestattete Populist*innen der Demokratie grundsätzlich schadeten. Voigt übt hingegen eine konzeptionelle Kritik am Argument von Schäfer/Zürn, die bereits in der Verlagerung von Entscheidungen auf nichtmajoritäre Institutionen eine regressive Tendenz sehen, indem er aus verfassungsökonomischer Perspektive darauf hinweist, dass stärker zwischen unterschiedlichen Typen nichtmajöritärer Institutionen unterschieden werden sollte.[1] Zwar hat Voigt dabei eine institutionenökonomische Differenzierung im Blick, jedoch macht es gerade auch demokratietheoretisch einen erheblichen Unterschied, ob eine Institution Abwehrrechte gegen den Staat oder die Preisstabilität im Euroraum garantieren soll.
Regression und Fortschritt
Die zweite Problemkonstellation ist philosophischer Natur und berührt das Verhältnis der Regression zum Konzept des Fortschritts. Dies geschieht vor dem Hintergrund der vermehrt geäußerten Kritik am klassischen Fortschrittsbegriff der Aufklärung, dem vorgeworfen wird, naive Geschichtsteleologie mit rassistischer Hierarchisierung zu kombinieren.[2] Vor diesem Hintergrund werden die Beiträge von den Fragen geleitet, inwiefern die Verwendung des Fortschrittsbegriff gerechtfertigt werden kann und die Regression überhaupt auf ein Konzept von Fortschritt festgelegt ist.
Rainer Forst hält am Fortschrittsbegriff fest und weist ein Verständnis von Regression zurück, das lediglich einen Rückfall hinter einst eingelösten Errungenschaften beschreibt. Statt an vergangenen Zuständen brauche es eine Orientierung an den rationalen Prinzipien der Vernunft, die ein nicht-teleologisches Verständnis von Fortschritt ermöglichten (199). Um den Ballast eines positiven Fortschrittbegriffs zu vermeiden, plädiert Niesen hingegen für einen rein negativ definierten „Imperativ der Nicht-Regression“ (208). Entgegen Forsts Forderung nach einer Orientierung an universellen Prinzipien sieht Niesen gerade in einem selbst-referentiellen und möglichst konkretem Bezug auf die eigene Unrechtsgeschichte den Schlüssel, um Regression zu verhindern, ohne in die „Imperialismusfalle“ zu tappen.
Demgegenüber verteidigt Jakob Huber den emanzipatorischen Fortschrittsbegriff und widerspricht explizit der Annahme Niesens, dass die Hinwendung zur Nicht-Regression die Begründungslast des positiven Fortschrittsbegriffs verringere. Diese Strategie verschiebe die Last lediglich, weil nun statt eines Ziels, „die Normativität der ‚Errungenschaften‘, hinter die zurückgefallen wird, gerechtfertigt werden“ (229) müssten. Damit sei nichts gewonnen, aber viel verloren, weil die negative Herangehensweise den Anspruch der Kritischen Theorie auf eine wünschenswerte Zukunft aufgebe. Vielmehr müsse es darum gehen, den geschichtsphilosophischen Ballast des Fortschrittsbegriff abzuwerfen, ohne die Vision eines besseren Morgens und Übermorgens gänzlich aufzugeben.
Regression und die "Krise der Demokratie"
Die dritte Problemkonstellation ist die ergiebigste, weil sie die Grundlagen fast aller wissenschaftlichen Debatten um die Krise der Demokratie berührt. Sie betrifft die Frage nach dem angemessenen Demokratieverständnis, das für jede demokratische Regressionsdiagnose von entscheidender Bedeutung ist. Schließlich gehört die Demokratie zu den „essentially contested concepts“ (Gallie 1956), deren Bedeutung notorisch umstritten bleiben muss. So hängt die Frage, ob man die Schwächung von verfassungsrichterlicher Normenkontrolle als Ausdruck fehlender demokratischer Rechenschaftspflicht oder als Stärkung des Souveräns gegen undemokratische Verrechtlichung interpretiert, maßgeblich davon ab, was man unter Demokratie überhaupt versteht. Kurz: Die Einschätzung, ob eine Demokratie regrediert, hängt entscheidend davon ab, wie sie definiert, konzeptualisiert, operationalisiert und dann gegebenenfalls gemessen wird.
Diesen Zusammenhang pointiert offen zu legen, ist das große Verdienst des Beitrags von Philip Manow. Statt wie sonst üblich die Demokratie in den Blick zu nehmen, macht er eine „Beobachtung der gegenwärtigen Beobachtung von Demokratie“ (85).[3] Hierfür setzt er bei der empirischen Behauptung eines Qualitätsverlusts von Demokratien an und nimmt das etablierte Instrumentarium zur Demokratiemessung ins Visier, dem er einen „geradezu erschreckende[n] Mangel an methodologischer Reflexion“ (86) attestiert. Seine Kritik ist keine rein technisch-methodische, sondern zielt auf das „Verhältnis zwischen Demokratiekonzeption und Demokratiemessung“ (85). Konkret bedeutet dies, dass laut Manow die verwendete Demokratiekonzeption darüber entscheide, ob es überhaupt eine Regression gebe. Nun ist die Unmöglichkeit der Objektivität sozialwissenschaftlicher Messungen eine Trivialität, doch Manows Kritik geht viel weiter. Für ihn liegt den gegenwärtigen Krisendiagnosen ein Konflikt zwischen zwei konkurrierenden Demokratiekonzepten zugrunde: einerseits das supranational-konstitutionell eingehegte, liberale Demokratieverständnis, andererseits das minimalistische, das kollektive Selbstregierung und Volksherrschaft betont (17 f.).
Am Beispiel des wichtigsten politikwissenschaftlichen Demokratieindizes, „Varieties of Democracy“ (V-Dem), zeigt Manow, dass dieser „Demokratiekonflikt“ (Eberl/Jörke/Salomon 2022: 12) in der Forschungspraxis de facto immer schon zugunsten des liberalen Modells entschieden sei. So stelle die Kategorie „liberale Demokratie“ bei V-Dem die höchste Entwicklungsstufe dar, was eine „Gefährdung der Demokratie durch ein Zuviel an liberalem Konstitutionalismus konzeptionell von vornherein“ (91) ausschließe. Manows scharfsinnige Beobachtungen legen die Verstrickung der Demokratieforschung mit ihrem Gegenstand eindrucksvoll offen. Allein die Tatsache, dass er als „besonders theorieaffiner Politologe“ (Wolkenstein 2019) in die Tiefen der Codebücher empirischer Demokratieindizes eintaucht, ist bemerkenswert und höchst ertragreich, weil er seine Fundamentalkritik so stets an konkreten Items und Codierungen festmacht.
Als problematisch erscheint jedoch, dass Manow nicht darauf eingeht, dass V-Dem neben dem kritisierten „Liberal democracy index“ auch Indizes wie den „Participatory democracy index“ oder „Egalitarian democracy index“ bereitstellt, denen andere Demokratieverständnisse zugrunde liegen. Diese werden zwar deutlich seltener verwendet, insofern ist Manows Fokus durchaus nachvollziehbar, allerdings verschiebt sich das Problem vor diesem Hintergrund ein Stück weit von der Methodik von V-Dem hin zur Hegemonie liberal-demokratischer Präferenzen von Akademiker*innen bei der Auswahl ihrer Demokratieindizes.
Zusammengefasst sieht Manow in der Verallgemeinerung eines spezifischen Demokratieverständnisses auf das eine Ideale von Demokratie ein zentrales Problem der Demokratieforschung. Ohne dass sich die Autor*innen immer explizit darauf beziehen oder diese Beschreibung zwangsläufig teilen würden, lassen sich im Band drei mögliche Formen des Umgangs mit diesem Problem identifizieren.
Eine Möglichkeit, um die „institutionelle Überdeterminierung der Demokratie“ (134) zu umgehen, sieht Fabio Wolkenstein einer allgemeineren Konzeptualisierung von demokratischer Regression, die auf einem weniger konkreten Demokratiebild basiert. Einen Ansatzpunkt für so eine Konzeptionalisierung biete in einem ersten Schritt das „System der Rechte“ von Habermas (1994: 163), mit dem sich überprüfen lasse, ob eine Demokratie in der Lage sei, „individuelle und kollektive Autonomie gleichursprünglich und gleichrangig zu verwirklichen (29). In einem zweiten Schritt fordert er eine stärkere Rolle der Bürger*innen bei der Bestimmung demokratischer Regression. Als alltägliche „Verfassungsinterpretinnen und -interpreten“ (143) sollten sie eine zentrale Rolle bei Bewertung demokratischer (Rück-)Entwicklungen haben.
Dass dieser Vorschlag für die empirische Erforschung von Demokratie anschlussfähig ist, zeigt die Strategie von Norma Osterberg-Kaufmann eindrucksvoll. Diese lässt sich als eine transnationale Pluralisierung der Demokratie beschreiben und hat die Kernforderung, die Demokratieverständnisse der Menschen weltweit ins Zentrum der Forschung zu rücken. Schließlich zeige die Empirie, dass es global sehr unterschiedliche Vorstellungen von Demokratie gebe (326).
Statt das westlich-liberale Modell zu verabsolutieren oder in einen völligen Relativismus zu verfallen, müsse das Ziel lauten, sich anhand vorhandener Vorstellungen einem global geteilten demokratischen Kern anzunähern. So könnte sich beispielsweise herausstellen, dass die Institutionen der Wahl und der Stammesversammlung dem gleichen demokratischen Grundprinzip folgten (327). Ein solcher Ansatz, dessen methodische Herausforderungen Osterberg-Kaufmann ausführlich diskutiert, verspreche nicht nur einen theoretisch und empirisch gangbaren Weg zur Vermeidung einer einseitigen Verengung von Demokratie, sondern nehme auch explizit marginalisierte, nicht-westliche Praktiken der Demokratie in den Blick (308 f.).
Diesen Vorschlägen, die Manows Problemdiagnose grundsätzlich teilen, setzt Zürn gleich zu Beginn des Bandes einen anderen Ansatz entgegen. Er verweist darauf, dass der Befund der Regression und damit der Zusammenhang von Demokratieverständnis und Krisendiagnose durchaus „aus der Abhängigkeit von einer bestimmten Konzeption des normativen Ideals der Demokratie“ (56) gelöst werden könne, indem er den Sachverhalt auf eine erkenntnistheoretische Ebene hebt. Sein Argument lautet, dass keine Konzeption der Demokratie ohne ein Mindestmaß an geteilter Wahrheit auskommen könne. Weil Populist*innen mit ihrem „zwischen Relativismus und Absolutismus changierenden Wahrheitsverständnis“ (58) diese Minimalanforderung beschädigten, mache ihr Erfolg die Demokratie per se unmöglich.
Zürns dichte Rekonstruktion der Mechanismen gesellschaftlicher Produktion von Wahrheit und ihre Rückbindung an unterschiedliche Demokratietheorien ist beeindruckend, dennoch wird man schon allein aufgrund seiner zentralen Vokabeln – „liberales Wahrheitsregime“, „epistemische Autorität“, „politische Neutralität“ – den Verdacht nicht los, dass die vorgeschlagene Generalisierung des Regressionsbegriffs weiterhin eng an das Konzept liberaler Demokratie gebunden bleibt.
Ein gelungener Sammelband und der anti-elitäre Impetus der Demokratie
Insgesamt löst der Band seinen Anspruch, die Diagnose der demokratischen Regression zunächst auf Herz und Nieren zu prüfen und anschließend weiterzudenken, umfänglich ein. Mit der Analyse von Schäfer/Zürn als gemeinsamem Ausgangspunkt gelingt es, trotz der Pluralität von Perspektiven ein hohes Maß an Kohärenz zu gewährleisten. Auch wenn sich einige der Argumentationen zwischendurch etwas weiter von der Ausgangsdiagnose entfernen, ist der rote Faden stets erkennbar. Die unterschiedlichen Perspektiven ergänzen sich gegenseitig und leuchten den Begriff der demokratischen Regression in seiner Komplexität aus. Mit Beiträgen, in denen Theoretiker*innen Codebücher sezieren und Empiriker*innen nach Möglichkeiten der methodischen Umsetzung suchen, ist der Band nicht nur in mehrere Richtungen anschlussfähig, sondern auch innovativ.
Besonders herauszuheben ist das Trio Manow, Wolkenstein und Osterberg-Kaufmann, das die Diagnose der demokratischen Regression zum Anlass nimmt, um aus unterschiedlichen Stoßrichtungen eine Kritik der Demokratieforschung zu formulieren. Gemäß der Einsicht, dass ein Urteil nicht nur etwas über den Gegenstand, sondern auch viel über die Urteilenden verrät, zeichnen sie nach, wie bereits die Methodik, die vielen Krisendiagnosen zugrunde liegt, zugunsten des liberal-demokratischen Status quo ausfällt.
Daraus erwachsen zwei Konsequenzen: Erstens müsste die bereits bestehende Forschung zu der Frage intensiviert werden, ob die häufig zitierten Krisenerscheinungen tatsächlich Ausdruck einer Regression der Demokratie sind oder sie nicht vielmehr auf die Krise einer bestimmten liberal-demokratischen Regierungsweise verweisen, die unter dem Druck autoritärer Konkurrenz, explodierender Ungleichheit und eines entfesselten Finanzkapitalismus ins Schlittern gerät.
Zweitens muss die Demokratieforschung einen Umgang damit finden, dass ihre Begrifflichkeiten und Methoden nicht über den sozialen Konflikten schweben, sondern diese untrennbar mit ihrem Gegenstand verstrickt sind. Schließlich ist „Demokratie“ nicht einfach ein Konzept, das unterschiedlich definiert wird, sondern Ausdruck „auf politische Praxis bezogene[n] Denken[s]“ (Deppe 1999: 12). Eine Möglichkeit mit diesem Problem umzugehen, liegt in einer Demokratisierung der Demokratieforschung, die eine stärkere Berücksichtigung der vorhandenen Demokratieverständnisse in der Bevölkerung im Forschungsprozess fordert, um Entfremdungserfahrungen besser zu verstehen: Ganz gemäß dem anti-elitären Impetus der Demokratie, dass die größten „Experten[*innen] in eigener Sache“ (97) in letzter Instanz immer die Bürger*innen selbst sein müssen.
Anmerkungen
[1] Voigts Argumentation läuft auf eine Abschirmung wirtschafts- und finanzpolitischer Fragen vom als schädlich wahrgenommenen Einfluss der Wähler*innen hinaus. Diese neoliberale Demokratieskepsis ist von Biebricher (2021) und Slobodian (2019) hervorragend ideengeschichtlich rekonstruiert worden.
[2] Für eine Kritik des Fortschrittsbegriffs siehe Allen (2019) und einen weiteren Umgang damit Jaeggi (2023).
[3] Schon früher hatte Manow die Demokratieforschung mitverantwortlich für die Entdemokratisierung gemacht, Stichwort: „Demokratiegefährdung durch Demokratiegefährdungsdiskurse“ (Manow 2020: 124). Für eine kritische und aufschlussreiche Beobachtung der gegenwärtigen politikwissenschaftlichen Beobachtung von Demokratie siehe Manow (2024).
Literatur
- Allen, Amy (2019): Das Ende des Fortschritts. Zur Dekolonisierung der normativen Grundlagen der kritischen Theorie, Frankfurt/New York: Campus.
- Biebricher, Thomas (2021): Die politische Theorie des Neoliberalismus, Berlin: Suhrkamp.
- Gallie, Walter B. (1956): Essentially Contested Concepts, in: Proceedings of the Aristotelian Society 56, S. 167-198
- Deppe, Frank (1999): Politisches Denken im 20. Jahrhundert, Band 1 – Die Anfänge, Hamburg: VSA Verlag.
- Eberl, Oliver/Jörke, Dirk/Salomon, David (2022): Die Krise der Demokratie und der ‚Blick nach unten‘, in: Leviathan 50 (1), S. 12-28.
- Habermas, Jürgen (1994): Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats, Frankfurt am Main: Suhrkamp
- Jaeggi, Rahel (2023): Fortschritt und Regression, Berlin: Suhrkamp.
- Manow, Philip (2020): (Ent-)Demokratisierung der Demokratie, Berlin: Suhrkamp.
- Manow, Philip (2024): Unter Beobachtung. Die Bestimmung der liberalen Demokratie und ihrer Freunde, Berlin: Suhrkamp.
- Niesen, Peter (2021): ... denn sie wissen, was sie tun. Rezension zu „Die demokratische Regression. Die politischen Ursachen des autoritären Populismus" von Armin Schäfer und Michael Zürn, in: Soziopolis, online unter: https://www.soziopolis.de/denn-sie-wissen-was-sie-tun.html [letzter Zugriff: 26.02.2024].
- Niesen, Peter (2023): Zur Diagnose demokratischer Regression, Leviathan Sonderband: 40, Baden-Baden: Nomos.
- Schäfer, Armin/Zürn, Michael (2021): Die demokratische Regression. Die politischen Ursachen des autoritären Populismus, Berlin: Suhrkamp.
- Slobodian, Quinn (2019): Globalisten. Das Ende der Imperien und die Geburt des Neoliberalismus, Berlin: Suhrkamp.
- Wolkenstein, Fabio (2019): Lesenotiz zu Philip Manow: Die Politische Ökonomie des Populismus, in: Theorieblog, online unter: https://www.theorieblog.de/index.php/2019/03/lesenotiz-zu-philip-manow-die-politische-oekonomie-des-populismus-frankfurt-am-main-2018/ [letzter Zugriff: 26.02.2024].