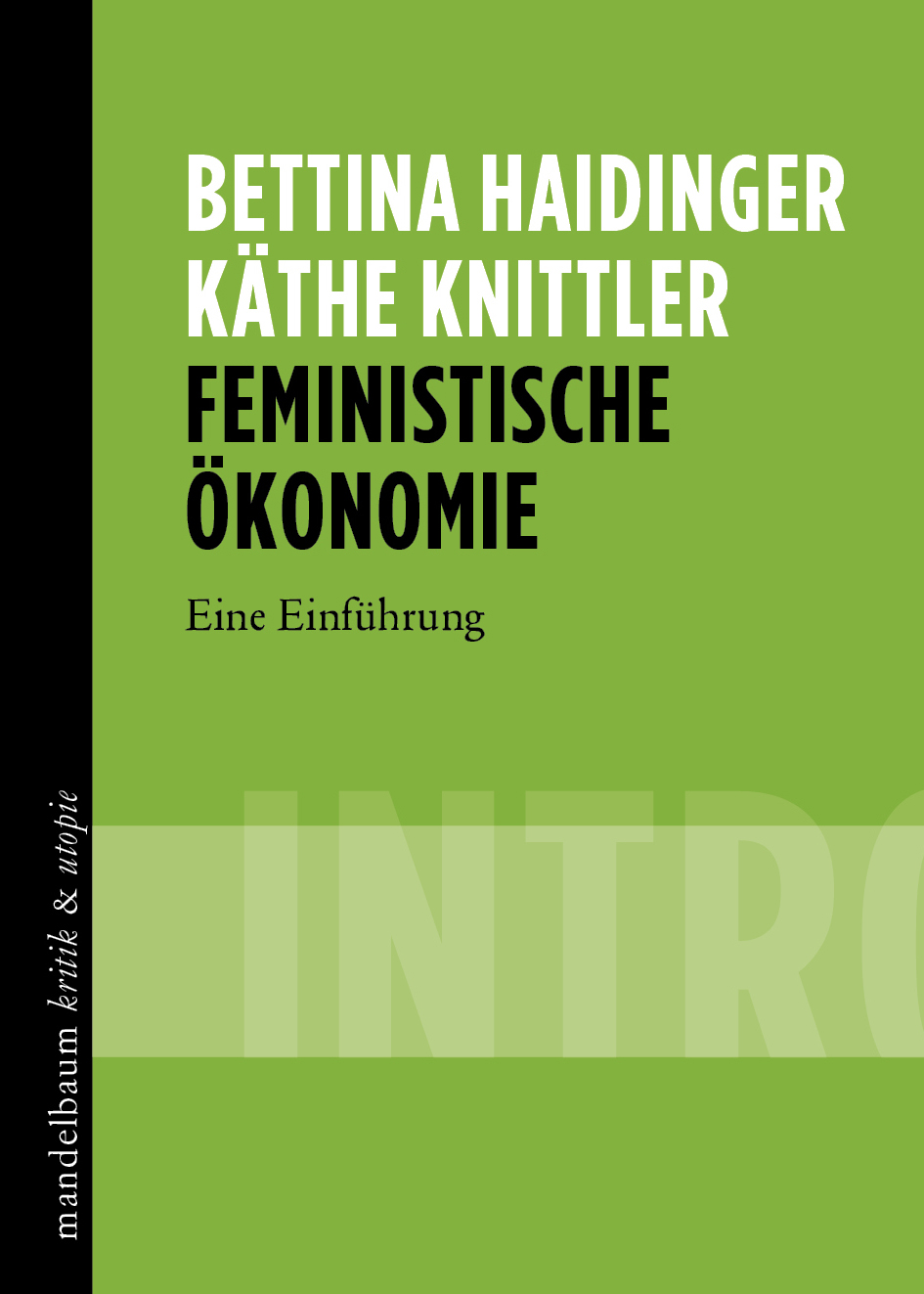Technik allein wird die Geschlechterfrage nicht lösen. Die Digitalisierung im Spannungsfeld gesellschaftlicher Wertvorstellungen
In der Debatte über die Digitalisierung werden vorhandene geschlechterspezifische Ungleichheiten und die Frage, ob diese in Zukunft dank Technik ins Positive verändert werden können, meist ausgeblendet. Deborah Oliveira hat daher im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung die einschlägige Forschungsliteratur zusammengetragen und kann so am historischen Beispiel der industriellen Revolution zeigen, dass eine an sich neutrale Technik auch genutzt werden kann, um die Arbeit von Frauen und deren gesellschaftliche Stellung zu entwerten. Ihre Studie versteht sie daher als Beitrag zur Diskussion über den Weg in eine geschlechtergerechte Arbeitswelt.
 Die einstige Textilfabrik im schottischen New Larnak ist Zeugnis eines Versuchs, die industrielle Revolution menschenfreundlich zu gestalten. Der Fabrikant und Reformer Robert Owen ließ das Gelände Anfang des 19. Jahrhundert ausbauen und versuchte dabei insbesondere, die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Frauen und Kinder zu verbessern. (Foto: Wohlleben).
Die einstige Textilfabrik im schottischen New Larnak ist Zeugnis eines Versuchs, die industrielle Revolution menschenfreundlich zu gestalten. Der Fabrikant und Reformer Robert Owen ließ das Gelände Anfang des 19. Jahrhundert ausbauen und versuchte dabei insbesondere, die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Frauen und Kinder zu verbessern. (Foto: Wohlleben).
Die Digitalisierung wird die Arbeitswelt grundlegend verändern und damit die Lebenswelt der Beschäftigten in Zukunft entscheidend prägen. Über die Chancen und Risiken dieser Transformation wird mittlerweile eine breite gesellschaftliche Debatte geführt – die geschlechterspezifischen Ungleichheiten in der Arbeitswelt und die Auswirkungen des Digitalisierungsprozesses auf die Geschlechterverhältnisse werden dabei aber meist ausgeblendet. Um rechtzeitig politisch aktiv zu werden und arbeitsrechtliche und bildungspolitische Rahmenbedingungen geschlechtergerecht zu gestalten, bedarf es also eines systematischen Einbezugs der Geschlechterperspektive. Zwar gibt es noch keine umfassende Studie zum Thema Digitalisierung und Geschlechterverhältnisse, doch wurde im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung Forschungsliteratur zusammengetragen, die hilft, das bisherige Dunkelfeld zu beleuchten – und die gleichzeitig zeigt, wie groß der Forschungsbedarf noch ist. Die Forschungsübersicht wurde im Mai 2017 als Working Paper veröffentlicht – der folgende Text ist eine Kurzfassung (hier geht es zur Langfassung)
Ein Blick in die Geschichte: Die Technisierung der Haushalte und die Idealisierung von Hausarbeit und Mütterlichkeit in Zeiten der industriellen Revolution
Die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Geschlechterverhältnisse sind schwierig vorherzusehen. Deswegen liegt ein Blick in die Geschichte nahe, um zu fragen, wie Technologien in der Vergangenheit die Lebensrealitäten von Frauen und Männern beeinflusst haben. Exemplarisch lässt sich dies an der Haushaltstechnisierung im Zuge der industriellen Revolution zeigen. Die historische Analyse offenbart nämlich Grundsätzliches zum Verhältnis von Technik und Kultur und von Kontinuität und Wandel.
Im vorindustriellen Haushalt waren Produktion und Reproduktion eine nicht auseinanderzuhaltende Einheit. Wenngleich Frauen und Männer für verschiedene Tätigkeiten im Haushalt zuständig waren, war die Arbeit von Frauen genauso geschätzt, weil beide in gleichem Maße dem Familienerwerb dienten (Bock und Duden 1977: 127, Heßler 2001: 54). Mit der Veränderung der Produktionsformen im Zuge der fortschreitenden Industrialisierung ging eine Neuaufteilung weiblicher und männlicher Arbeitsbereiche einher (Heßler 2001: 54 f.). Arbeit wurde somit in außerhäusliche Produktion und innerhäusliche Reproduktion geteilt. Die Produktion wurde entlohnt und zum Beruf, während die unentgeltliche Reproduktionsarbeit nicht mehr als Arbeit galt (Joris und Witzig 1984).
Die Veränderung der Produktionsformen im Zuge des Industrialisierungsprozesses hatte also eine grundlegende Neuordnung und -bewertung der Geschlechterverhältnisse zur Folge, die vor allem in einer Abwertung weiblicher Arbeit bestand. Der Haushalt wurde mit der fortschreitenden Industrialisierung immer stärker politisiert und zum Gegenstand staatlichen Interesses: Die Auswirkung der individuellen Haushaltsführung auf die Volkswirtschaft wurde betont, ein liebevolles „Heim“ wurde als Grundlage einer gesunden Gesellschaft verstanden (Heßler 2001: 254; Sachse 1990: 50). Neue wissenschaftliche Disziplinen wie Hygiene, Pädagogik und Psychologie lieferten die neuen Normen für die Haushaltsführung und Kindererziehung. Bürgerliche Frauen nahmen sich dieser Aufgabe bereitwillig an und stimmten ihrerseits in die ideologische Überhöhung der Hausarbeit ein, indem sie unter dem Schlagwort „organisierte Mütterlichkeit“ einen genuin weiblichen Beitrag zum Staat konstruierten. Dies bot Frauen einen gesellschaftlich akzeptierten Weg, sich über die weibliche Sphäre Gehör im öffentlichen Diskurs zu verschaffen – gleichzeitig wurden so die gerade beginnenden Emanzipationsbestrebungen in einen eng begrenzten geschlechterspezifischen und häuslichen Bereich kanalisiert (Stalder 1984: 377). Politische Teilhabe war für Frauen also auf alle Haushalts- und Familienbelange beschränkt und konnte nur über diese „mütterlichen“ Interessen wahrgenommen werden.
Die Industrialisierung brachte jedoch auch für Frauen neue Möglichkeiten, einer Erwerbsarbeit außer Haus nachzugehen. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch, dass Frauen kaum in großer Zahl an Fabrikarbeit beteiligt waren. Zahlen aus England, Frankreich und Italien verweisen alle auf etwa folgende Verteilung: Etwa ein Drittel der Frauen arbeitete im Dienstleistungssektor, also vor allem als Dienstbotinnen in fremden Haushalten, 20 Prozent waren in Heimarbeit mit Kleidungsproduktion beschäftigt, während bloß 15 Prozent in der Textilindustrie, also in Fabriken, arbeiteten (Scott und Tilly 1984: 101). Die neuen Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen entstanden also vor allem in traditionell weiblichen Bereichen, die der Hausarbeit sehr nahe sind. Obwohl mit der neuen Technik und den motorgetriebenen Maschinen eigentlich allfällige Kraftdifferenzen zwischen den Geschlechtern für die Erwerbschancen irrelevant geworden wären, setzte sich doch eine geschlechterspezifisch segregierte Arbeitsteilung durch. Die für Frauen zugänglichen Berufe waren somit ihrer Anzahl und Art nach begrenzt. Außerdem wurden sie beinahe nur von jungen und unverheirateten Frauen ausgeübt und gleich nach der Heirat wieder aufgegeben (ebd.: 104). Die neuen technischen Möglichkeiten boten also emanzipatorisches Potenzial, das aber nicht genutzt wurde, da die bestehenden Geschlechterverhältnisse es gleich wieder einschränkten und die neuen Maschinen nach bestehenden kulturellen Vorstellungen genutzt wurden.
Sowohl in der historischen Forschung als auch im öffentlichen Bewusstsein ist gemäß Martina Heßler (2001) der Mythos verbreitet, die Haushaltstechnisierung hätte die Berufstätigkeit von Frauen ermöglicht. Sie argumentiert gegen diesen angeblichen Zusammenhang, indem sie aufzeigt, dass die Haushaltstechnisierung in den zeitgenössischen Diskursen fast nie im Kontext der potenziellen Berufstätigkeit diskutiert wird: Vielmehr waren es vor allem Hausfrauenverbände und Hauswirtschaftlerinnen, die in der Technisierung des Haushalts eine Möglichkeit zur Aufwertung der Hausfrauenrolle sahen (ebd.: 203). Technik war für diese Interessensgruppe ein Mittel, um den Haushalt zu professionalisieren, zu verwissenschaftlichen und damit an die männliche Produktionssphäre anzugleichen (ebd.: 223). Mit der Angleichung an die Männerberufe, so ihre Überlegung, würde gesellschaftliche und staatliche Anerkennung einhergehen. Heßler erkennt in diesem Mythos eine Überschätzung der Bedeutung von Technik bei gleichzeitiger Unterschätzung gesellschaftlicher und kultureller Werte, insbesondere derjenigen, die sich auf Geschlechterverhältnisse beziehen (ebd.: 395). Sie argumentiert, Frauen seien in erster Linie berufstätig geworden, „weil sie entweder auf das Einkommen angewiesen waren oder sich gesellschaftliche Wertvorstellungen geändert haben, indem die Berufstätigkeit der Frau kein Stigma sozial schwächerer Schichten mehr war, sondern für den sozialen Status gar notwendig wurde“ (ebd.) und nicht weil Technik sie erst in die Lage dazu versetzte.
Die Geschichte der Haushaltstechnisierung im Zuge der Industrialisierung und ihr Effekt auf die Geschlechterverhältnisse sind ambivalent. So ermöglichte die Konstruktion der Hausarbeit als ein genuin weiblicher Beitrag zur Gesellschaft einerseits vielen Frauen den Zugang zur politischen Debatte und machte damit die dichotom gedachten Sphären von Öffentlichkeit und Privatheit durchlässig. Andererseits verstärkten sie die Vorstellung von genuin weiblichen und männlichen Eigenschaften und verfestigten die bürgerliche geschlechterspezifische Rollenteilung und ihre Ungleichheiten (Heßler 2001: 384). Auch im Alltag vieler Frauen brachte die Haushaltstechnisierung viele Vorteile, wie die körperliche Entlastung oder die relative zeitliche und räumliche Unabhängigkeit und bietet so auch Möglichkeiten zur Verbindung von Beruf und Haushalt. Diese Vorteile werden aber allzu oft von erhöhten Anspruchsniveaus aufgefangen, sodass Haushaltstechnik genauso die Verbindung von Berufs- und Hausarbeit erleichtern wie erschweren kann (Methfessel 1990). Entscheidend scheint hier nicht die Haushaltstechnik, sondern deren kulturelle Nutzung – solange Hausarbeit noch immer als weibliche Aufgabe verstanden wird und sich Männer nicht in gleichem Maße daran beteiligen, wird auch die Haushaltstechnik keine Chancengleichheit herstellen können. Die Technik hat in dieser Hinsicht die Hausarbeit nicht wie erhofft aufwerten können und hat nicht per se zu mehr Geschlechtergerechtigkeit beigetragen (ebd.: 145).
Neben der festgestellten Ambivalenz in Bezug auf die Geschlechterverhältnisse lässt sich an den historischen Entwicklungen auch Grundlegendes zum Verhältnis von Kultur und Technik und von Wandel und Kontinuität erkennen. Oft entsteht der Eindruck, der Prozess der Technisierung ergebe sich aus den der Technik immanenten Eigenschaften, der Prozess scheint fast autodynamisch zu sein. Die historische Analyse aber offenbart, dass die Entwicklung zwar aus heutiger Sicht selbstverständlich scheint, jedoch in hohem Maße kontingent ist. So zeigt Martina Heßler, dass wir unsere Wäsche genauso gut in Gemeinschaftswaschküchen waschen oder an ein Dienstleistungsunternehmen zur Wäsche auslagern könnten – dass uns das Modell des individualisierten Haushalts so natürlich scheint, ist das Ergebnis eines langwierigen und komplexen historischen Prozesses (Heßler 2001: 20). Barbara Orland (1991) betont, dass Haushaltstechnik ein kulturelles Produkt ist, das in bestimmter Weise die soziale Ordnung einer Arbeit abbildet – sonst wäre weder deren Entwicklung noch die Durchsetzung möglich gewesen. Die Technik hatte aber dann einen großen Einfluss auf die weitere Entwicklung der Arbeit und der Geschlechterverhältnisse. Die Hausarbeit wurde grundlegend umstrukturiert, was dazu führte, dass die Frage nach Sinn und Nutzen der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung nicht gestellt wurde, da die Nachteile nie in vollem Maße sichtbar wurden, sondern die Symptome eines strukturellen Problems durch technische Hilfsmittel bekämpft werden sollten (Orland 1991: 284 f.). Martina Heßler hält fest, dass gesellschaftliche Nutzungen von Technik keineswegs von der Technik determiniert, sondern kulturell vielfältig und historisch wandelbar sind (Heßler 2001: 396). Die Diskurse um den Siegeszug der Technik und der Glauben an die Unaufhaltsamkeit des Fortschritts seien zwar wirkmächtige Faktoren gewesen, die das Handeln verschiedener Gruppen beeinflussten (ebd.: 83), dennoch werde die gesellschaftliche Nutzungsweise nicht durch die Bedeutungszuschreibungen determiniert. So ist auch in der sozialwissenschaftlichen und technikhistorischen Literatur die lange vorherrschende Vorstellung einer eigengesetzlichen Technikentwicklung und ihrer Determinierung der gesellschaftlichen Auswirkungen überholt. Inzwischen hat sich die wissenschaftliche Debatte von der Dichotomie der Technikdeterminierung einerseits als auch von der übermäßigen Betonung der Nutzerfreiheit unter Vernachlässigung der Strukturen andererseits abgewendet: Empirische Untersuchungen unterstützen die Annahme eines vermittelnden „Sowohl als auch“1 .
Die genderspezifischen Auswirkungen der Digitalisierung – Vier Schlaglichter aus einer Geschlechterperspektive
Eine zentrale Frage in Bezug auf die Digitalisierung und Frauenerwerbstätigkeit ist, ob und inwiefern die Digitalisierung das Potenzial in sich birgt, gegenwärtige geschlechtsspezifische Ungleichheiten aufzubrechen und damit einen Beitrag zu mehr Geschlechtergerechtigkeit zu leisten. Fest steht, dass die neuen Technologien nicht per se eine emanzipatorische Wirkung ausüben, sondern dass es auf ihre kulturell-gesellschaftlich auszuhandelnde Nutzungsweisen ankommt. Es ist also durchaus zu erwarten, dass die Digitalisierung ambivalente Folgen haben wird und sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt. Im Folgenden wollen wir die Forschungsdebatten näher betrachten, in denen versucht wird, diese Chancen und Risiken zu antizipieren.
Plattformen und Crowdwork – Chancen und Risiken der digitalen Arbeit
Crowdwork ist eines der im Rahmen der Digitalisierungsdebatte am meistdiskutiertesten Themen, da es schon jetzt in manchen Bereichen des Arbeitsmarktes radikal andere Formen der Arbeitsorganisation und Beschäftigung hervorbringt und deswegen gerne als Beispiel herangezogen wird, um die Folgen der disruptiven digitalen Technologien für die Zukunft der Arbeit zu verdeutlichen. Der Begriff Crowdsourcing beschreibt die Auslagerung von Aufgaben an eine undefinierte Zahl von Crowdworkern über einen Aufruf im Internet (Leimeister et al. 2015). Unternehmen sind also nicht mehr durch interne Arbeitskapazitäten beschränkt, sondern können jederzeit über das Internet auf eine große Reserve an potenziellen Arbeitskräften zugreifen. Die Auftraggeber, Crowdsourcer genannt, können über neuartige Internetplattformen Aufgaben ausschreiben, die dann von Crowdworkern verrichtet werden. Die Arbeitsinhalte erstrecken sich über unterschiedliche Branchen und Aufgabenbereiche und über unterschiedliche Anforderungsniveaus. Zu den oft als Clickwork bezeichneten Mikro-Aufgaben gehören unter anderem die Beschriftung von Fotos, die Kategorisierung von Produkten oder die Bewertung von Dienstleistungen, zu den etwas besser entlohnten Makro-Aufgaben gehören das Verfassen von Produkt- oder Dienstleistungsrezensionen oder das Testen von Softwareprodukten. Auch kleinere Projekte wie das Erstellen von Softwarecodes oder das Design von Produkten werden bereits oft an eine Crowd ausgelagert. Dabei entsteht ein neuer Tätigkeitsbereich der Aufgabendekomposition; damit Arbeitspakete von Crowdworkern erfolgreich bearbeitet werden können, müssen sie in kleinere Einheiten zerlegt und konkretisiert werden (ebd.). Die Teilaufgaben erfordern dementsprechend weniger Kenntnisse und Fähigkeiten, sodass sie geringer entlohnt werden können.
Eine Studie von Leimester et al. (2016) liefert erstmals demografische Daten zu Crowdworkern in Deutschland, die erste Hinweise auf die tatsächliche Situation dieser Arbeitskräfte bietet. Die Ergebnisse zeigen, dass die Geschlechteranteile auf Marktplatz-, Design- und Testing-Plattformen relativ ausgeglichen sind – bloß auf Microtask-Plattformen sind zwei Drittel der befragten Crowdworker männlich. Entgegen der Vermutung, Crowdworker seien unqualifizierte Arbeitskräfte, waren die befragten Crowdworker sehr gut ausgebildet, jede/r Zweite/r verfügte über einen Hochschulabschluss (ebd.). Die Mehrheit verrichtet die Arbeit auf einer Crowdworking-Plattform jedoch nebenberuflich. Sehr aussagekräftig ist auch der Befund, dass bei Microtask-, Design- und Testing-Plattformen etwas mehr als die Hälfte der Befragten eine Festanstellung mit ähnlichen Tätigkeiten präferieren würde (ebd.). Dieser Befund weist vermutlich auf die prekären Arbeitsbedingungen in der Crowd hin; von den Befragten, die ihr Haupteinkommen durch Crowdwork generieren, versichern sich 34 Prozent nicht selbst gegen Krankheit und Arbeitslosigkeit und 47 Prozent sorgen nicht für ihre Altersrente (ebd.). Crowdwork könnte daher in westlichen Industrienationen als ein Ausdruck von Prekarisierungstendenzen verstanden werden. Im Gegensatz dazu birgt Crowdwork unter anderen ökonomischen Bedingungen enorme Chancen, wenn die lokalen Lebenskosten im globalen Vergleich sehr tief sind und Crowdwork in strukturschwachen Gegenden erst Arbeitsmöglichkeiten schafft. Auch für viele Frauen, die noch Sorgepflichten wahrnehmen, ist die Arbeit in der Crowd geeignet, um trotzdem einer Erwerbsarbeit nachzugehen. Global gesehen ist Crowdwork somit zugleich inklusiv, indem es neue Gruppen in den Arbeitsmarkt einbindet, und gleichzeitig prekär, was an den fehlenden rechtlichen Sicherheiten der Crowdworker sowie der niedrigen Entlohnung erkennbar ist.
Nicht nur digitale Arbeit wird über Plattformen vermittelt, sondern es entstehen auch zunehmend Plattformen für Dienstleistungen, die zuvor von angestellten Arbeitskräften bewältigt wurden (Valenduc und Vendramin 2016). Während temporäre Einsätze lange nur im Bereich der saisonalen Arbeit üblich waren, wird die Arbeit auf Abruf nun auch in Bereichen mit einem kontinuierlichen, aber schwankenden Bedarf an Arbeitskräften immer verbreiterter. Dies betrifft etwa Tätigkeiten wie Pflege von Bedürftigen in ihren eigenen vier Wänden, Kinderbetreuung, Einzelhandel oder den Eventbereich. Die meisten Beschäftigten in diesen Fällen sind Frauen, die mit unvorhersehbaren Arbeitszeiten und schwankendem Verdienst arbeiten (ebd.: 35). Die Erwartungen an eine ständige Verfügbarkeit sind hoch, ihre Aufstiegschancen sehr begrenzt und die arbeits- und sozialrechtliche Absicherung äußerst gering, was meist zu einer Unzufriedenheit mit der eigenen Arbeitssituation führt (ebd.).
Neue Kommunikationstechnologien und flexible Arbeit
Die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien ermöglichen zunehmend mobiles Arbeiten; durch „Business Media“ können räumlich verteilte Projektteams dezentral arbeiten und sich im virtuellen Raum treffen (Kirschenbauer 2015: 42). Ein immer größerer Teil der Arbeit findet digital statt, Beschäftigte verbringen einen Großteil ihrer Zeit mit dem Bearbeiten von Emails oder mit Online-Recherchen (Carstensen 2016: 41). Diese technischen Möglichkeiten zur orts- und zeitunabhängigen Arbeit bergen Chancen für eine bessere Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und anderen Lebensbereichen, eine flexiblere Alltagsgestaltung und eine Reduktion der arbeitsbedingten Mobilität und könnten damit zu einer höheren Lebensqualität beitragen (Carstensen 2015: 189). Die Möglichkeit, jederzeit und von überall zu arbeiten, könnte insbesondere Menschen mit Sorgeverpflichtung, also mehrheitlich Frauen, neue Karrierechancen bieten – durch Kinderbetreuungszeiten begrenzte Präsenzmöglichkeiten im Büro können flexibel durch selbst einteilbare Zusatzarbeitsstunden ergänzt werden.
Die Auflösung der Grenze zwischen beruflichen und privaten Lebensbereichen birgt für die Arbeitnehmer*innen jedoch nicht nur Chancen, sondern wird oft einseitig zum Vorteil der Arbeitgeber*innen ausgelegt. Oft werden diese Grenzüberschreitungen gar nicht mehr als solche wahrgenommen: Für viele Beschäftigte gehört der verpflichtende Besuch von Abendveranstaltungen des Unternehmens, das Lesen von Fachlektüre in der Freizeit oder das Empfangen und Senden von E-Mails außerhalb der Arbeitszeit wie selbstverständlich dazu (Roth-Ebner 2015: 189). Die Erwartungen hinsichtlich der Erreichbarkeit steigen mit den erweiterten technologischen Möglichkeiten also deutlich: 27 Prozent der Beschäftigten sind bereits sehr häufig oder häufig außerhalb der Arbeitszeiten erreichbar (DGB-Index Gute Arbeit 2012: 10), laut anderen Umfragen ist es gar die Mehrheit der Beschäftigten (Roth-Ebner 2015: 195). Die verlängerte Erreichbarkeit wird aber nicht als Arbeitszeit anerkannt, wodurch es zu einer systematischen Arbeitszeitverlängerung kommt, die weder vergütet noch kompensiert werden kann (Maschke 2016: 11). Festzustellen ist nicht bloß eine Tendenz zur Ausdehnung der Arbeitszeit, sondern auch eine zunehmende Arbeitsverdichtung. Das bedeutet, dass die Anforderungen und Verantwortlichkeiten in der Arbeitszeit steigen und dass mehr Leistung in derselben Arbeitszeit erbracht wird (Maschke 2016). Dies zeigen diverse Befragungen von Beschäftigten, die den Eindruck haben, immer mehr in derselben Zeit leisten zu müssen (Lohmann Haislah 2012; DGB-Index Gute Arbeit 2015). Auch örtlich gebundene Arbeitnehmer*innen erledigen vermehrt im Rahmen von Überstunden Arbeit zu Hause, die zuvor nicht abgeschlossen werden konnte – ein Phänomen, für das Roth-Ebner den Begriff komplementäre Telearbeit verwendet (Roth-Ebner 2015: 193).
In der Debatte um Arbeitszeiten und die Auswirkungen von Flexibilisierung und Entgrenzung im Zuge der Digitalisierung darf nicht außer Acht gelassen werden, dass Flexibilität für Männer und Frauen Verschiedenes bedeuten kann. Auch heute noch wird der überwiegende Anteil von Hausarbeit, Pflege- und Betreuungstätigkeiten von Frauen ausgeübt. So zeigt sich denn auch, dass Arbeitszeitautonomie von Frauen eher für private Aktivitäten und eine gute Work-Life-Balance genutzt wird, während Männer mit flexiblen Arbeitszeiten oft sogar noch mehr Zeit in die Erwerbsarbeit investieren (Lott 2014; 2015). Dies drohe den „Gender Time Gap“ zu vergrößern und die bestehenden Ungleichheiten in Bezug auf die Verteilung bezahlter und unbezahlter Arbeit zwischen den Geschlechtern zu verstärken (ebd.). Die Grenzen zwischen Arbeit und anderen Lebensbereichen lösten sich nur für Männer auf, während Frauen noch immer an Zeiteinschränkungen außerhalb der Arbeit gebunden sind, wie etwa die Öffnungszeiten von Kindertagesstätten oder Schulferien (ebd.).
Nadine Absenger et al. (2014) zeichnen ein noch düstereres Bild: Mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen seien die Anforderungen einer entgrenzten Arbeit kaum von beiden Partnern, Mann und Frau – geschweige denn als Alleinerziehende –, zu erfüllen (Absenger et al. 2014). Als Reaktion auf diesen Zeitdruck und die nicht zu bewältigenden Aufgaben trete oft ein Partner – noch immer meist die Frau – beruflich zurück und bilde mit ihrer Teilzeitarbeit oder gar Auszeit den privaten „Puffer“ für die gestiegenen Belastungen der Männer (oder selten umgekehrt) (ebd.: 51). In diesem Sinne plädiert Rubery (2015) für reguläre und begrenzte Arbeitszeiten, die zur Gleichstellung der Geschlechter beitragen. Ohne regulierte Arbeitszeit könnten Frauen mit Kindern nur schwer Vollzeit arbeiten und Männer würden sich seltener in der Kinderbetreuung engagieren (Rubery 2015:163). Lange und unregulierte Arbeitszeiten sowie unbezahlte Überstunden für Vollzeitbeschäftigte verhinderten auch die Teilzeitarbeit in der Branche oder im Unternehmen, da Voll- und Teilzeit nicht gleich behandelt werden können (ebd.). Abschließend lässt sich in Bezug auf Arbeitszeitmodelle sagen, dass trotz der ambivalenten Folgen der Wunsch nach mehr Zeitautonomie zunimmt und das gesellschaftliche Bedürfnis einer besseren Ausbalancierung von Arbeit und anderen Lebensbereichen wächst (Carstensen 2016; Kirschenbauer 2015). Immer mehr Menschen möchten auf Vertrauensbasis auch selbstbestimmt und von unterwegs oder zu Hause arbeiten können – die technologischen Bedingungen dafür sind jedenfalls zunehmend gegeben, die Präsenzzeit am Arbeitsplatz verliert kontinuierlich an Bedeutung. Immer mehr Männer möchten heutzutage als Vater aktiv am Leben ihrer Kinder teilhaben und für sie präsent sein – Kirschbauer (2015: 69) stellt so auch in ihren Interviews mit Männern den zunehmenden Wunsch nach einer Arbeitszeitreduktion fest. Beide Geschlechter sehen die neuen Technologien als Chance, flexibler zu arbeiten und eine bessere Work-Life-Balance zu erreichen (ebd.).
Zentral sind wohl zwei Faktoren, damit flexible Arbeitszeitarrangements zu mehr Geschlechtergerechtigkeit führen können: Erstens muss die Flexibilisierung im Interesse der Arbeitnehmenden ausgestaltet werden und darf nicht einseitig durch entgrenzte und verdichtete Arbeitsanforderungen seitens des Arbeitsgebers ausgenutzt werden (Lott 2015). Und zweitens bedarf es eines grundlegenden Wandels der Geschlechterverhältnisse: Solange die Problematik der Vereinbarkeit nur Frauen betrifft, kann eine gleichberechtigte Teilhabe beider Geschlechter an der Arbeitswelt nicht verwirklicht werden. Männer müssen die neue Flexibilität genauso für andere Lebensbereiche einsetzen wollen, damit sich die Arbeitskultur hin zu einer neuen Akzeptanz von Lebensentwürfen jenseits der Norm des männlichen Idealarbeiters wandelt.
Neue Karrierepraxen und die Vereinbarkeitsfrage
Die Digitalisierung ermöglicht durch IT-basierende Controlling- und Berichtssysteme in großen Unternehmen neue Formen der Arbeitsorganisation. Ziele können auf einzelne Bereiche, Abteilungen und gar Mitarbeiter*innen heruntergebrochen werden und mithilfe von Kennzahlen kann deren Erfolg auf allen Ebenen gemessen werden (Boes et al. 2014: 17). Dies schafft mehr Transparenz und gleichzeitig einen erhöhten Konkurrenzdruck, indem ständig die Leistungen zwischen Abteilungen, Teams und sogar einzelnen Beschäftigten verglichen werden (‚Benchmarking‘) (ebd.: 17 f.). Mit der neuen Transparenz, die mit einer kennzahlenbasierten Steuerung einhergeht, werden auch Karriereentscheidungen professionalisiert. Für Frauen ist diese Professionalisierung ein Vorteil, da mit der neuen Transparenz durch zentral definierte Auswahlkriterien „homosoziale Rekrutierungsmuster“ (also die Tendenz von Führungskräften, ihnen ähnliche Mitarbeitende zu fördern – das heißt Männer fördern eher Männer) durchbrochen werden. Unternehmen haben außerdem zusätzlich die Möglichkeit, verbindliche Zielvorgaben für den Anteil von Frauen in Führungspositionen festzusetzen und Gleichstellung als Kennzahl in der Bewertung von Führungskräften zu berücksichtigen (Bultemeier 2015: 276). Diese Verbindlichkeit und Messbarkeit von Gleichstellungsbestrebungen sind ein neues und effektives Instrument, um die Karrierechancen von Frauen zu verbessern.
Der Wandel der Karriereentscheidungen hat aber gleichzeitig auch negative Auswirkungen auf Frauen mit Karriereambitionen. Ihr Potenzial muss nämlich nicht nur von ihren unmittelbaren Vorgesetzten wahrgenommen werden, sondern muss auch Führungskräfte aus anderen Abteilungen und Bereichen überzeugen (ebd.: 269). Dazu ist ein großer Mehraufwand nötig, um unternehmensweite Sichtbarkeit zu erzeugen, beispielsweise über das Engagement in Pilotprojekten, Taskforces oder wichtigen Kundenschulungen. Uneingeschränkter Einsatz für das Unternehmen durch lange Arbeitszeiten und Arbeit am Wochenende werde von Führungskräften noch immer oft mit Führungspotenzial gleichgesetzt (ebd.: 274). Eine eingeschränkte zeitliche Verfügbarkeit für das Unternehmen erweist sich meist als Ausschlusskriterium für eine Karriere, wie an der Verneinung von Teilzeitkarrieren sowie der fehlenden Akzeptanz von Erwerbsunterbrechungen deutlich wird (ebd.: 274). Die Karriereambitionen von Teilzeitbeschäftigten werden meist gar nicht erkannt, da Teilzeit als Ausdruck fehlender Bereitschaft verstanden wird, sich ganz der Arbeit zu widmen (ebd.). Dazu kommt, dass Teilzeitbeschäftigte oft über keine Kapazitäten für Zusatzprojekte und die öffentliche Positionierung verfügen und damit nicht unternehmensweit sichtbar werden können. Unterbrechungen der Erwerbsarbeit sind ebenso wenig akzeptiert und werden häufig als Widerspruch zu Führungsambitionen verstanden (ebd.: 275). Außerdem gibt es im Karriereprozess angelegte Eigenlogiken, die Unterbrechungen sanktionieren: Die Bewährungsproben und die unternehmensweite Sichtbarkeit sind informelle, soziale Prozesse, die nicht dokumentiert werden und daher bei einem Wiedereinstieg nicht mehr nachweisbar sind.
Die Normalitätserfahrung vieler Frauen in den Unternehmen ist, dass Karriere und Familie sich gegenseitig ausschließen. Auch für Männer ist es nur möglich, sowohl eine Karriere als auch eine Familie zu realisieren, wenn sie durch traditionelle Geschlechterrollen von der Sorgearbeit befreit werden – den Männern gelingt es also nicht wirklich, Karriere und Familie zu vereinbaren, vielmehr wird damit die Vereinbarkeitsproblematik auf Frauen ausgelagert (Bultemeier 2015). Zwar nimmt bei jungen Männern der Wunsch zu, sich beispielsweise an der Sorgearbeit für ihre Kinder zu beteiligen und eine ausgeglichenere Work-Life-Balance zu leben. Aber auch sie können sich den Verfügbarkeitserwartungen der Unternehmen und der Ausschließlichkeit des Karriereprozesses nicht entziehen und scheitern oft an der Umsetzung ihres Wunsches. Noch immer zementieren also die Karrierepraxen der Unternehmen traditionelle Geschlechterrollen. Doch die neuen Ansprüche der jungen Männer, wenn sie auch im Unternehmen meist nicht umgesetzt werden können, schaffen eine breitere Grundlage, um die Vereinbarkeitsproblematik zu thematisieren und einen grundlegenden Kulturwandel in der Arbeitswelt anzustoßen (ebd.: 285).
Die Besonderheit sozialer und pflegerischer Berufe in der Digitalisierung
Obwohl personenbezogene Dienstleistungen zwar nicht völlig technisierungs- und digitalisierungsresistent sind, können sie doch nicht ohne Weiteres durch digitale oder virtuelle Angebote ersetzt werden (Baethge und Baethge-Kinsky 2016: 23). Außerdem sind sie durch ihren Charakter als soziale und wesentlich zwischenmenschliche Tätigkeit, die auf unmittelbarer menschlicher Interaktion beruht, nicht im gleichen Maße einem globalen Wettbewerb ausgesetzt, da die Arbeit nicht an einen beliebigen geografischen Ort ausgelagert werden kann. In den Substitutionsprognosen wird den sozialen und pflegenden Berufen gerade einmal ein Substituierbarkeitspotenzial von zehn bis zwanzig Prozent attestiert (ebd.: 48). Der Bedarf an Personal im sozialen und Pflegebereich wird also nicht abnehmen, vor allem wenn man den demografischen Wandel und seine Auswirkungen berücksichtigt. Aus dieser Zukunftssicherheit, auch im Angesicht der Digitalisierung, wird gelegentlich auf eine zukünftige Aufwertung der personenbezogenen Berufe geschlossen.
Die feministische Ökonomin Silke Chorus widerspricht dieser Schlussfolgerung jedoch (Chorus 2013). Sie erkennt vielmehr einen strukturellen Abwärtsdruck auf Löhne im Care-Bereich, der mit fortschreitender Digitalisierung noch zuzunehmen droht. Care-Leistungen und die Pflege von anderen Menschen können nicht einer unbegrenzten Effizienzsteigerung und Rationalisierung unterzogen werden. Die Zeitverdichtung in der Pflege führt zu einem unmittelbaren Qualitätsverlust (ebd.: 256). In anderen Wirtschaftszweigen steigt mit zunehmender Digitalisierung jedoch die Produktivität und umgekehrt sinken die Produktionskosten; Technologien machen im Vergleich zur menschlichen Arbeitskraft einen immer größeren Teil der Wertschöpfung aus. Dieses Prinzip der technologischen Produktivitätssteigerung lässt sich nur sehr begrenzt auf die Care-Arbeit übertragen, sodass der relative Wert von Care-Arbeit steigt und Care-Leistungen immer teurer werden (ebd.: 277). Das bedeutet, dass entweder die Löhne von Care-Arbeiterinnen unter enormem Abwärtsdruck stehen und die Qualität der Pflege abnimmt oder aber der Preis von Care enorm steigt. Ebendiese Care-Berufe werden aber wegen ihrer Standortbindung, der Digitalisierungsresistenz sowie der demografischen Überalterung für einen wachsenden Anteil der Beschäftigten die Einkommensgrundlage darstellen (ebd.). Daher plädiert inzwischen eine wachsende Anzahl von Forscher*innen und Aktivisten*innen dafür, bei den sozialen Berufen ein anderes Produktivitätsverständnis anzulegen als im Bereich der Industrie und den Wert von Sorgearbeit gesellschaftlich zu verhandeln.
Fazit – wie weiter?
Der Blick in die Geschichte hat gezeigt, wie die Industrialisierung und die Haushaltstechnisierung eine neue geschlechtliche Arbeitsteilung und damit einhergehende Abwertung weiblicher Arbeit zur Folge hatten. Die neuen technischen Möglichkeiten boten zwar emanzipatorisches Potenzial – durch die industrielle Produktionsweise werden Kraftdifferenzen unerheblich, die Haushaltstechnik würde Zeit für eine Erwerbstätigkeit freisetzen –, das aber nicht genutzt wurde, da die neuen Maschinen nach aufkommenden bürgerlichen Vorstellungen im Sinne einer absoluten Verschiedenheit der Geschlechter genutzt wurden. Die gesellschaftlichen Nutzungsweisen ergeben sich also keineswegs aus der Technik selber. Die historische Analyse macht deutlich, dass die Entwicklung zwar aus heutiger Sicht zwangsläufig scheint, jedoch kontingent ist. Diese Kontingenz bedeutet aber auch eine Chance, die Weichen für eine technische Entwicklung gesellschaftlich bewusst zu stellen.
Der Fokus auf neue Kommunikations- und Informationstechnologien offenbart sowohl vielversprechende Potenziale im Hinblick auf flexiblere Arbeitszeitarrangements und damit eine bessere Vereinbarkeit von Arbeit mit anderen Lebenssphären als auch beunruhigende Tendenzen der Entgrenzung und Verdichtung von Arbeit. Die Analyse vorherrschender Karrierepraxen und Laufbahnmechanismen in den Betrieben macht deutlich, wie die Strukturen der Arbeitswelt fast ausschließlich Lebensentwürfe fördern, mit denen sich die Menschen dem Unternehmen zeitlich und emotional uneingeschränkt zur Verfügung stellen. Damit wird das Potenzial der neuen Technologien für eine bessere Vereinbarkeit unterschiedlicher Lebensbereiche untergraben. Der von vielen Paaren gewünschte Lebensentwurf einer partnerschaftlichen und egalitären Arbeitsteilung, bei der beide Partner sich aktiv an der Betreuungsarbeit beteiligen, scheint angesichts der strukturellen Erfordernisse der Erwerbssphäre oft nicht umsetzbar. Die Chancen der Digitalisierung können nur zum Zuge kommen, wenn die Nutzungsweisen der digitalen Technologien nicht mehr von der ‚Rund-um-die-Uhr‘-Arbeitskultur bestimmt werden.
Die Pflege von anderen Menschen kann nicht einer unbegrenzten Rationalisierung und Effizienzsteigerung unterzogen werden. Zeitverdichtung in der Pflege führt unmittelbar zu einem Qualitätsverlust. Damit droht der relative Wert von Care-Arbeit im Vergleich mit digitalisierter Arbeit zu steigen und damit Care-Leistungen teurer zu werden. Da ebendiese Berufe aber wegen ihrer Standortbindung, der demografischen Entwicklung und ihrer Digitalisierungsresistenz die Einkommensgrundlage für einen wachsenden Teil der Beschäftigten darstellen wird, scheint es unausweichlich, den Wert von Care-Arbeit gesellschaftlich zu verhandeln und sie nicht rein ökonomischen Bewertungskriterien zu unterziehen.
Die Digitalisierung bietet sowohl für die Geschlechtergerechtigkeit als auch für die Zukunft der Arbeit zahlreiche Chancen und Potenziale, gleichzeitig aber auch Risiken einer weiteren Verschärfung bestehender Probleme. Die Konsequenzen der Digitalisierung werden sich jedoch nicht allein aus den technologischen Möglichkeiten ableiten lassen, sondern ergeben sich aus den kulturell-gesellschaftlichen Nutzungsweisen dieser Technologien. Die Digitalisierung ist politisch gestaltbar – in diesem Sinne lässt sich als Ausblick nur dafür plädieren, sie als Chance für eine breite Debatte darüber zu nutzen, wie wir in Zukunft als Gesellschaft arbeiten und leben wollen.
1Joerges, Bernward (Hrsg.): Technik im Alltag. Frankfurt 1988; Lutz, Burkart (Hrsg.); Technik im Alltag und Arbeit. Berlin 1989; Hörnig, Karl H.: Alltägliches. Wie die Technik in den Alltag kommt und was die Soziologie dazu zu sagen hat. In: Technik und Gesellschaft. Jahrbuch 3, 1985, S. 13-35; Hampel, Jürgen/ Mollenkopf, Heidrun/ Weber, Ursula/ Zapf, Wolfgang: Alltagsmaschinen. Berlin 1991.
Literatur
Absenger, Nadine et al. (2014): Arbeitszeiten in Deutschland. Entwicklungstendenzen und Herausforderungen für eine moderne Arbeitszeitpolitik. WSI Report, 19. November: https://www.boeckler.de/pdf/p_wsi_report_19_2014.pdf
Baethge, Martin / Baethge-Kinsky, Volker (2016): Entwicklung des Arbeitsmarktes unter geschlechtsspezifischen Aspekten – Expertise im Rahmen des Zweiten Gleichstellungsberichts der Bundesregierung.
Bock, Gisela / Duden, Barbara (1977): Arbeit aus Liebe – Liebe als Arbeit. Zur Entstehung der Hausarbeit im Kapitalismus. In: Berliner Sommeruniversität für Frauen (Hrsg.): Frauen und Wissenschaft. Berlin: Courage Verlag. S. 118-199.
Boes, Andreas et al. (2014): Informatisierung und neue Entwicklungstendenzen von Arbeit. In: Industriesoziologische Studien. Jahrgang 7, Heft 1, 5-23.
Bultemeier, Anja (2015): Karriere und Vereinbarkeit – Geschlechtsspezifische Auswirkungen einer neuen Karrierepraxis in Unternehmen. In: Ulla Wischermann / Annette Kirschenbauer (Hrsg.): Geschlechterarrangements in Bewegung: Veränderte Arbeits- und Lebensweisen durch Informatisierung?. Bielefeld. transcript Verlag, S. 255-292.
Carstensen, Tanja (2015): Neue Anforderungen und Belastungen durch digitale und mobile Technologien. WSI Mitteilungen 3, S. 187-193: https://www.boeckler.de/wsimit_2015_03_carstensen.pdf
Carstensen, Tanja (2016): Ambivalenzen digitaler Kommunikation am Arbeitsplatz. In: Aus Politik und Zeitgeschichte 18-19, S. 18-19: http://www.bpb.de/apuz/225698/ambivalenzen-digitaler-kommunikation-am-arbeitsplatz?p=all
Chorus, Silke (2013): Care-Ökonomie im Postfordismus – Perspektive einer integralen Ökonomie-Theorie. Münster: Westfälisches Dampfboot.
DGB-Index Gute Arbeit (2012): Arbeitshetze, Arbeitsintensivierung, Entgrenzung. So beurteilen Beschäftigte die Lage. Berlin.
DGB-Index Gute Arbeit (2015): Report 2015: Ursachen der Arbeitshetze. Berlin.
Heßler, Martina (2001): „Mrs. Modern Woman“. Zur Sozial- und Kulturgeschichte der Haushaltstechnisierung. Frankfurt/ New York: Campus Verlag.
Joris, Elisabeth/Witzig, Heidi (1984): Die ewigen Töchter oder die verpasste Revolution: Überlegungen zur Entwicklung der „Töchterberufe“. In: Frauen. Zur Geschichte weiblicher Arbeits- und Lebensbedingungen in der Schweiz. Sonderausgabe von Vol. 34, 1984, Nr. 3 der Schweizerischen Zeitschrift für Geschichte. Basel: Schwabe & Co. AG Verlag, S. 357-362.
Kirschenbauer, Annette (2015): Neuformierung von Arbeit und Leben durch Informatisierung? Projektergebnisse – Empirische Auswertungen. In: Ulla Wischermann / Annette Kirschenbauer (Hrsg.): Geschlechterarrangements in Bewegun. Veränderte Arbeits- und Lebensweisen durch Informatisierung? Bielefeld: transcript Verlag, S. 25-117.
Leimeister, Jan Marco et al. (2015): Neue Geschäftsfelder durch Crowdsourcing: Crowd-basierte Start-ups als Arbeitsmodell der Zukunft. In: Rainer Hofmann / Claudia Bodegan (Hrsg.): Arbeit der Zukunft. Möglichkeiten nutzen – Grenzen setzen. Frankfurt/ New York: Campus Verlag, S. 141 – 158.
Leimeister, Jan Marco et al. (2016): Crowd Worker in Deutschland – Eine empirische Studie zum Arbeitsumfeld auf externen Crowdsourcing-Plattformen.
Lohmann-Haislah, Andrea (2012): Stressreport Deutschland 2012. Psychische Anforderungen, Ressourcen und Befinden, Bundesanstalt fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Dortmund.
Lott, Yvonne (2014): Flexibilität und Autonomie in der Arbeitszeit: Gut für die Work-Life Balance? Analysen zum Zusammenhang von Arbeitszeitarrangements und Work-Life Balance in Europa. WSI Report 18. November: https://www.boeckler.de/pdf/p_wsi_report_18_2014.pdf
Lott, Yvonne (2015): The Need For A Gender Perspective On Digitalization. In: Social Europe. 05.08.2015.
Maschke, Manuela (2016): Flexible Arbeitszeitgestaltung. FES WISO Diskurs.
Methfessel, Barbara (1990): Zwischen drei Welten. Mütter, Hausfrauen, erwerbstätige Frauen und ihre haushaltstechnischen Hilfen. In: Arbeitsgemeinschaft Hauswirtschaft und Stiftung Verbraucherinstitut (Hrsg.): Haushaltsträume. Ein Jahrhundert Technisierung und Rationalisierung im Haushalt. Begleitbuch zur gleichnamigen Ausstellung/ bearb. von Barbara Orland. Königstein im Taunus: Langewiesche. S. 137-147.
Orland, Barbara (1991): Wäsche waschen. Technik- und Sozialgeschichte der häuslichen Wäschepflege. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
Roth-Ebner, Caroline (2015): Die Mediatisierung von Arbeit und die Neuformierung von Lebensbereichen. In: Ulla Wischermann / Annette Kirschenbauer (Hrsg.): Geschlechterarrangements in Bewegung. Veränderte Arbeits- und Lebensweisen durch Informatisierung? Bielefeld: transcript Verlag, S. 183-208.
Rubery, Jill (2015): Geschlechtsspezifische Aspekte der Arbeitsmarktregulierung. In: Rainer Hofmann / Claudia Bodegan (Hrsg.): Arbeit der Zukunft: Möglichkeiten nutzen – Grenzen setzen. Frankfurt/ New York: Campus Verlag, S. 159-181.
Sachse, Carola (1990): Anfänge der Rationalisierung der Hausarbeit in der Weimarer Republik. In: Arbeitsgemeinschaft Hauswirtschaft und Stiftung Verbraucherinstitut (Hrsg.): Haushaltsträume. Ein Jahrhundert Technisierung und Rationalisierung im Haushalt. Begleitbuch zur gleichnamigen Ausstellung/ bearb. von Barbara Orland. Königstein im Taunus: Langewiesche. S. 49-61.
Scott, Joan W./Tilly, Louise A.(1984): Familienökonomie und Industrialisierung in Europa. In: Claudia Honegger / Bettina Heintz (Hrsg.): Listen der Ohnmacht. Zur Sozialgeschichte weiblicher Widerstandsformen. Frankfurt a. M.: Europäische Verlagsanstalt. S. 99-137.
Stalder, Anne-Marie (1984): Die Erziehung zur Häuslichkeit. Über den Beitrag des hauswirtschaftlichen Unterrichts zur Disziplinierung der Unterschichten im 19. Jahrhundert in der Schweiz. In: Frauen. Zur Geschichte weiblicher Arbeits- und Lebensbedingungen in der Schweiz. Sonderausgabe von Vol. 34, Nr. 3 der Schweizerischen Zeitschrift für Geschichte. Basel: Schwabe & Co. AG Verlag. S. 370-384.
Valenduc, Gérard/Vendramin, Patricia (2016): Work in the Digital Economy – Sorting the Old from the New. Working Paper 2016.03. Brussels: European Trade Union Institute.
Debatte
Jessi Hempel
Siri and Cortana Sound Like Ladies Because of Sexism
Wired, 25. Oktober 2015
Adrienne LaFrance
Why Do So Many Digital Assistants Have Feminine Names? Hey Cortana. Hey Siri. Hey girl
The Atlantic, 30. März 2016
Laurie Penny
Why do we give robots female names? Because we don't want to consider their feelings
New Statesman, 22. April 2016
Aus der Annotierten Bibliografie
zum Thema