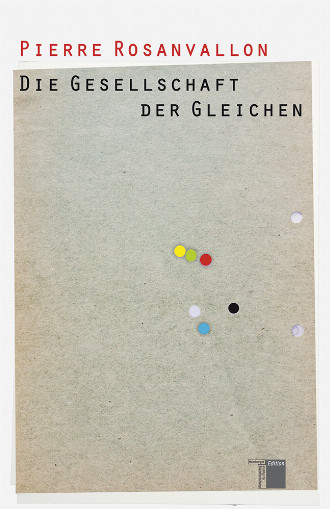Pierre Rosanvallon: Die Gegen-Demokratie. Politik im Zeitalter des Misstrauens
Demokratie sei heute Misstrauensdemokratie, befindet Pierre Rosanvallon in seiner Analyse zum Stand der westlichen Demokratien. Die Fortschritte der Demokratie hätten diese in eine negative, strafende und überwachende Demokratie gewandelt. Sie sei schwach und negativ geprägt. Sie sehne sich nach einem richterlichen Urteil, nicht nach Diskurs und Deliberation. Und sie sei unpolitisch geworden, vornehmlich, weil der Bürger sich als Mitproduzent von Politik verabschiedet habe, ohne aber seine Kontrolle aufgeben zu wollen.
Pierre Rosanvallon, Professor für neuere Geschichte am Collège de France, hat mit „Gegen-Demokratie“ eine Analyse zum Stand der westlichen Demokratien vorgelegt. Darin argumentiert er, die Fortschritte der Demokratie hätten diese in eine negative, strafende und überwachende Demokratie gewandelt – die so aber zugleich eine schwache Demokratie sei. Am Ende seiner knapp 300 Seiten starken Analyse schlägt er vor, wie wir diese organischen Veränderungen in eine institutionelle Weiterentwicklung von Demokratie umwandeln können. Denn ein „zurück“ erscheint ihm unwahrscheinlich.
Der Autor nähert sich seinem Thema rein theoretisch-historisch. Es ist ein Buch des Diskurses, der geschichtlichen Analyse. Das Buch ist in vier Abschnitte gegliedert: I. Die Überwachungsdemokratie, II. Souveränität als Verhinderung, III. Das Volk als Richter und IV. Die Unpolitische Demokratie. In einem Fazit greift der Autor klar erkennbar Aristoteles auf, wenn er von einem „gemischten System der Moderne“ schreibt.
Zunächst einmal ist Gegen-Demokratie für ihn nicht das Gegenteil von Demokratie, sondern der Versuch, ein demokratisches Misstrauen aus Gründen der Stabilität in ein liberales politisches System zu integrieren (14). Früh wird deutlich, dass er ständiges Protestieren und reine Kritik von NGO-Watchdogs allein für nicht zielführend hält. Er spricht von „negativer gesellschaftlicher Souveränität“ (19). Ebenso hat er aber den „Geburtsfehler der parlamentarischen Regierungsform“ (10) fest im Blick: Der durch Wahlen erzielten Repräsentation, die aufgrund einer ihr innewohnenden „repräsentativen Entropie“ (18) eine Entfremdung zwischen Herrschenden und Beherrschten verursachen könne. Seine Grundidee besteht im Folgenden darin, Überwachungsinstitutionen (neu) zu formulieren. Am Ende entwickelt er die Umrisse eines neuen politischen Systems, doch die vier Abschnitte des Buches selbst sind zunächst einmal eine Analyse. Sie liefern noch keine Veränderungsvorschläge des Autors, sondern versuchen zu vermessen, wohin sich unsere Westliche Demokratie schleichend entwickelt hat.
Überwachungsdemokratie
Ziel dieses Kapitels ist es, aus der geschichtlichen Entwicklung herzuleiten, dass Demokratie einerseits immer aus einem Wechselspiel zwischen Amtsträgern und – mal mehr, mal weniger institutionalisierten – Gegengewichten bestand. Die öffentliche Meinung etwa sei stets als ständige Überwachung der Politik gedacht (34 f.) und habe den Rang einer Quasi-Institution (42). Und auch wenn „Denunziation“ – heute Whistleblowing – immer ein Teil derselben gewesen sei, habe doch die Forderung nach immer mehr Transparenz zu einer überdimensionierten Politik des Misstrauens geführt (48). Umso wichtiger sei die persönliche Reputation eines Politikers geworden und habe gar Wahlen als wichtigsten Regelmechanismus ersetzt (50). Überhaupt habe eine „Entsakralisierung von Wahlen“ (106) stattgefunden. Doch „die“ öffentliche Meinung gibt es ohne deren Organisation nicht. Und die Organisatoren, die Journalisten, die er als potenzielle Rivalen zu Politikern sieht (96), hätten an Macht verloren. Die Abstimmung über diese Reputation finde heute im Internet statt. Dieses sei buchstäblich die Überwachungsform schlechthin geworden (68). Fazit: Bei allen Demokratien stehe heute die Überwachung der Regierung im Vordergrund.
Souveränität als Verhinderung
Der zweite Abschnitt knüpft gedanklich an den ersten an. Neben einem Entscheidungsrecht von Herrschenden sei in der politiktheoretischen Diskussion immer schon ein Verhinderungsrecht bestimmter Gegen-Institutionen mitgedacht worden. Heute nenne man das Veto-Mächte, in Anlehnung an das „Veto“ römischer Tribunen, die der Römischen Republik die Befugnis hatten, politische Entscheidungen aufzuhalten. Erst im 18. und 19. Jahrhundert habe sich die Diskussion von Gegen-Institutionen so verschoben, dass man nicht mehr in gesonderten Einrichtungen (Ephoren, Tribunen) dachte, sondern die Aufgabe bei der parlamentarischen Opposition verortete, die Regierung in Schach zu halten. Problematisch sei aber, wie heute der notwendige Widerspruch ausgefüllt werde. Radikale Gegenentwürfe gebe es nicht mehr; dies sieht er als den eigentlichen Triumph des Liberalismus an (163). Die Unzufriedenen hätten die Rebellen ersetzt (155). Unzufriedenheit und Obstruktion dominierten – auch, weil Gegenwehr leichter zu organisieren sei als der Kampf um ein positives Zukunftsziel. Und auch Wahlen, die Herrschende zur Ausübung von Souveränität legitimieren, seien zu einer Abstrafungsveranstaltung geworden. Der vielfach beliebten Zivilgesellschaft hält er dabei entgegen, staatliche Politik nicht ersetzen zu können. Denn trotz schöner Worte sei aus ihrer einstigen Vitalität vor allem eine „Verteidigung bornierter Gruppeninteressen“ (115) geworden. Von einer „strafenden Demokratie“ müsse man heute sprechen (156). Kurzum: Negative Demokratie hat für Rosanvallon zahlreiche historische Vorbilder; heute aber sei Demokratie (zu) negativ und zugleich (zu) schwach und ziellos.
Das Volk als Richter
Die Überschrift dieses Abschnitts ist ein wenig irreführend. Eigentlich geht es um die Verrechtlichung der (politischen) Welt. Rosanvallon beginnt das Kapitel mit der Feststellung, dass „politisch“ und „rechtlich“ sich heute zunehmend überlagerten (176). Der Richter selbst sei zu einer politischen Instanz erhoben worden – und dies ist die Kernaussage des Kapitels. Erneut zieht er zunächst eine Linie aus der Vergangenheit. Im Mittelalter sei die Exekutive noch Judikative gewesen. Vom König wurde verlangt, Recht zu sprechen (184). Erst allmählich entzog sich diese Aufgabe seiner Kontrolle und wurde Gerichten übertragen. Im Zuge der Demokratisierung blieb aber eines klar: Die Regierung zur Verantwortung zu ziehen – dies war am Ende die Aufgabe des mündigen Bürgers. In Wahlen – oder, wie mit dem recall in den USA – in Abwahlen. Den Regierungen falle in einer immer komplexeren Welt angesichts notwendiger Verhandlungen, Berücksichtigung von Proporzen und zunehmend komplizierten Prozessen aber die Entscheidungsfindung immer schwerer – und der sie beobachtenden Bevölkerung falle es immer schwerer, Geduld für die lange Entscheidungsfindung aufzubringen und die Entscheidungen dann nachzuvollziehen. Man sehne sich vielmehr nach dem Richter, der mit dem Hammerschlag ein Urteil setzt, Dispute beendet und Resultate schafft.
Die Unpolitische Demokratie
Durch die beschriebenen Prozesse sinke automatisch die Autorität von Regierung und Politik überhaupt. Der Bürger – eigentlich hat er in einer Demokratie die Aufgabe, Mitproduzent von Politik zu sein – verwandle sich immer mehr in einen „anspruchsvollen Politikkonsumenten“ (230) mit Hang zum Richteramt. Man kann das Grundproblem dann so zusammenfassen: „[…D]as große Problem von heute besteht darin, dass die Demokratie zwar erstarkt, aber in einer vornehmlich indirekten Form, während das Politische im eigentlichen Sinne verfällt“ (232). Die Politik reagiere meist bedauernswert: Sie sei zunehmend bereit, sich selbst zu erniedrigen, um dem Volk zu signalisieren, seine Wünsche zu hören. In diesem Sinne interpretiert er Populismus um: Er sei pure Anti-Politik, Ausdruck reiner, unpolitischer Politik, indem er die Idee vom Volk als Richter ins Destruktive übersteigere (243, 246).
Ganz kurz zusammengefasst lautet seine 250-seitige Analyse also: Demokratie sei heute Misstrauensdemokratie. Sie sei schwach und negativ geprägt. Sie sehne sich nach einem richterlichen Urteil, nicht nach Diskurs und Deliberation. Und sie sei unpolitisch geworden, vornehmlich weil der Bürger sich als Mitproduzent von Politik verabschiedet habe, ohne aber seine Kontrolle aufgeben zu wollen. Doch die wird bequem ausgeübt: Als reines „Dagegen-Sein“.
Soweit die Analyse, der man zustimmen kann oder nicht. Doch was nun?
Zunächst einmal sieht Rosanvallon keine seligmachende Lösung in direkter Demokratie. Partizipation könne man nicht zur „Garantin des demokratischen Fortschritts“ erklären (269). Vielmehr müsse man die entstandene Gegen-Demokratie konsolidieren. Er plädiert für ein „gemischtes System der Moderne“ (283 ff.). Dazu müssten die eher globalen Arenen von (sozialen und anderen) Medien und von zivilgesellschaftlichen Organisationen irgendwie in die eher nationalstaatlichen demokratischen Institutionen integriert werden. Etwa, indem man darüber nachdenkt, den lauten, vielstimmigen, zivilgesellschaftlichen Protest in Bahnen zu lenken und zivilgesellschaftliche Ratingagenturen zu schaffen, um staatliches Handeln zu bewerten (273). Oder durch eine Repolitisierung, sodass Politik wieder stärker Politik sein darf. An dieser Stelle bleibt Rosanvallon aber leider ausgesprochen vage. Wie das konkret vonstattengehen könnte, dazu findet sich nichts Handfestes in seinem Text. Letztlich deutet er an, dass Politik sich womöglich stärker vom Nationalstaat lösen müsste.
Das Buch liest sich auch deshalb mit Gewinn, weil Rosanvallon viele interessante Überlegungen gelingen. Selbst wenn am Ende der ganz große Wurf einer neuen Basis für Demokratie für viele ausbleiben wird, lohnt sich die Lektüre, um die vielen kleinen Goldnuggets einzusammeln, die er bietet. Problematisch ist beizeiten der Wortbombast („Ausdrucksdemokratie“, „Mitwirkungsdemokratie“). Worte, die im Kopf des Lesenden zwar Assoziationen erzeugen, die aber dennoch konturlos bleiben. Hierauf hätte man verzichten können.
Wer aber ernsthaft darüber nachdenken möchte, wie die Zukunft der Demokratie aussehen könnte, ohne automatisch direkte Demokratie zu fordern oder auf die Fata Morgana einer technischen Demokratie zu setzen, sollte das Buch lesen. Gerade auch, weil es keine Dünnbrettbohrerei ist. Dabei muss man gar nicht immer seiner Meinung sein (was der Rezensent auch überhaupt nicht ist). Es ist dennoch ein bemerkenswertes Buch.
Sammelrezension
Die Krise der westlichen Demokratien. Erscheinungsformen und Ursachen
Westliche Demokratien befinden sich heute in einer Krise, die Erinnerungen an die Zwanziger- und Dreißigerjahre des vergangenen Jahrhunderts weckt. Knapp drei Jahrzehnte nach dem Sieg der westlichen Demokratien im Systemkonflikt mit den sozialistischen Volksdemokratien ist diese Entwicklung verstörend, schreibt Joachim Krause. Das Thema wurde erst langsam in der Politik wahrgenommen; mittlerweile ist es Gegenstand einer Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen, von denen in dieser Sammelrezension vier Bücher näher vorgesellt werden.
weiterlesen
Aus der Annotierten Bibliografie
zum Thema
Demokratie gestalten – zum Verhältnis von Repräsentation und Partizipation
Sammelrezension
Die Krise der westlichen Demokratien. Erscheinungsformen und Ursachen
Westliche Demokratien befinden sich heute in einer Krise, die Erinnerungen an die Zwanziger- und Dreißigerjahre des vergangenen Jahrhunderts weckt. Knapp drei Jahrzehnte nach dem Sieg der westlichen Demokratien im Systemkonflikt mit den sozialistischen Volksdemokratien ist diese Entwicklung verstörend, schreibt Joachim Krause. Das Thema wurde erst langsam in der Politik wahrgenommen; mittlerweile ist es Gegenstand einer Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen, von denen in dieser Sammelrezension vier Bücher näher vorgesellt werden.
weiterlesen