Kandidatenaufstellung zur Bundestagswahl 2017. Über personelle und partizipatorische Grundlagen demokratischer Ordnung
Die Rekrutierung von Abgeordneten gilt als ein Kernstück der Repräsentation und ist, wie Suzanne S. Schüttemeyer und Anastasia Pyschny ausführen, als solche wesentlich für die Anerkennungswürdigkeit der demokratischen Ordnung und damit letztlich für die Stabilität des politischen Systems. Die Autorinnen setzten sich mit der Funktionsweise und Qualität von Repräsentation auseinander und stellen Befunde der Rekrutierungsforschung, insbesondere des Projektes über die Kandidatenaufstellung zur Bundestagswahl 2017 vor, das vom Institut für Parlamentarismusforschung durchgeführt wurde.
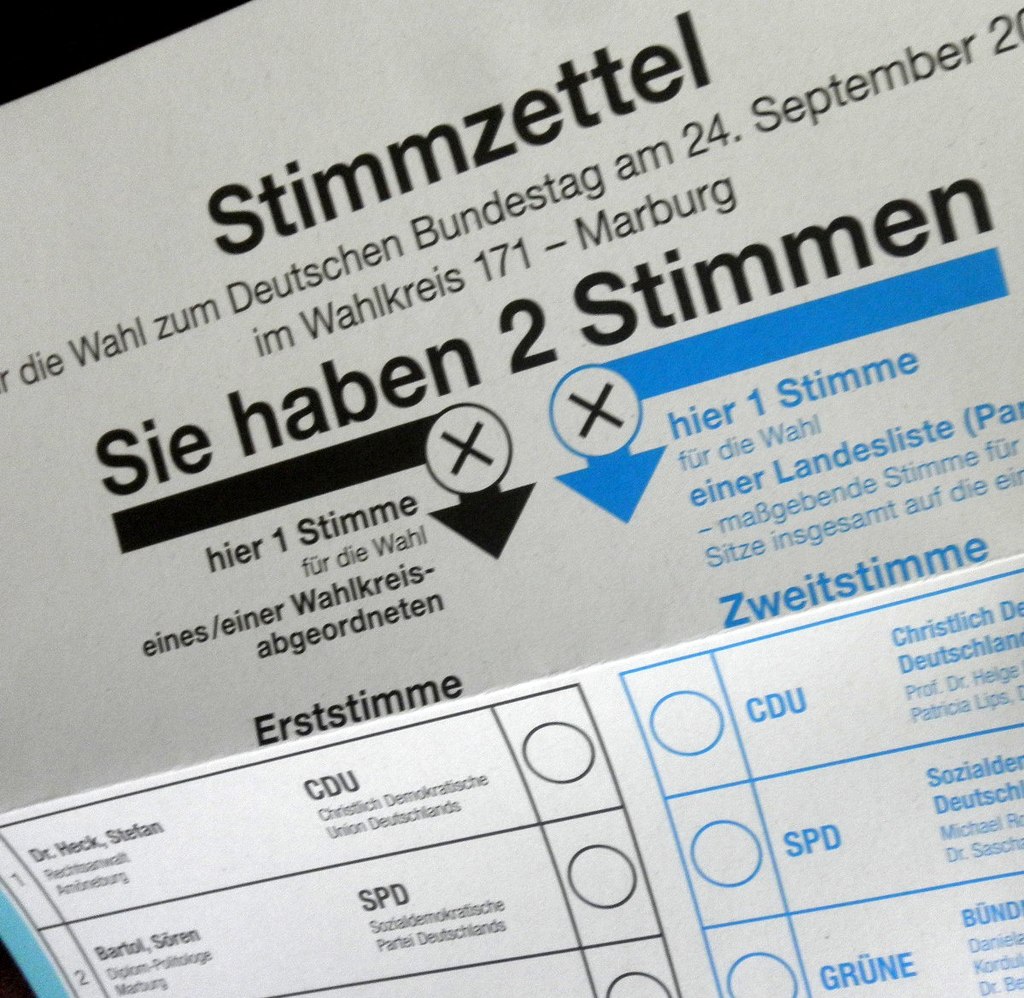 Wie kommen die Kandidat*innen auf den Stimmzettel? Diese Frage wurde vom Instituts für Parlamentarismusforschung (IParl) umfassend für die Bundestagswahl 2017 untersucht. Foto: Bluemel1 / Wikimedia Commons (Lizenz CC BY SA 4.0)
Wie kommen die Kandidat*innen auf den Stimmzettel? Diese Frage wurde vom Instituts für Parlamentarismusforschung (IParl) umfassend für die Bundestagswahl 2017 untersucht. Foto: Bluemel1 / Wikimedia Commons (Lizenz CC BY SA 4.0)
Was Ernst Fraenkel bereits 1958 in einem Vortrag auf der Jahrestagung der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft zur repräsentativen und plebiszitären Komponente im demokratischen Verfassungsstaat resümierte, trifft auch heute noch unverändert zu: „Der Bestand der Demokratie im Staat hängt von der Pflege der Demokratie in den Parteien ab.“ In der Sprache der jüngeren Politikwissenschaft würde man sagen, dies sei auf die Input-Seite gemünzt gewesen, da es Fraenkel darum ging, „dass den plebiszitären Kräften innerhalb der Verbände und Parteien ausreichend Spielraum gewährt“1 werde.
Dasselbe trifft aber auch auf die „Output-Seite“ zu: Demokratie wird nur von Dauer sein, wenn die Entscheidungen, die die Parlamente als demokratisch legitimierte Letztentscheidungsinstanzen treffen, im Großen und Ganzen überzeugen – sowohl im Sinne objektiver Problemlösung als auch der Akzeptanz bei den Bürgern. Dies kann nur gelingen, wenn die Parlamentarier über spezifische Fähigkeiten verfügen, um diese Leistung zu erbringen. Und damit kommt den Parteien eine außerordentliche Verantwortung zu, denn das politische Personal wird innerhalb der Parteien rekrutiert. Folglich steht und fällt der Bestand der Demokratie in doppelter Hinsicht mit ihrer Pflege in den Parteien.
Trotz der überragenden Bedeutung der Rekrutierungsfunktion der Parteien hat es in der Bundesrepublik Deutschland seit fast fünf Jahrzehnten keine empirische Studie gegeben, die die Kandidatennominierung für die Bundestagswahlen umfassend untersucht, also die Fragen beantwortet hat, wer wen wie und warum für eine Kandidatur im Wahlkreis und auf der Landesliste auswählt und aus welchen Gründen sich Parteimitglieder dazu entschließen. Damit tat sich zwischen Parteien- und Partizipationsforschung einerseits, Parlaments-, Eliten- und Abgeordnetenforschung andererseits eine erstaunliche Lücke auf.
Die Abgeordnetenrekrutierung ist als „Scharnier“2 zwischen der Gesellschaft, organisiert in den Parteien, und der Politik, fokussiert im Parlament, bezeichnet worden. Sie ist ein Kernstück der Repräsentation und als solche wesentlich für die Anerkennungswürdigkeit der demokratischen Ordnung und damit letztlich für die Stabilität des politischen Systems. Eine Untersuchung der Rekrutierung ist daher unabdingbar, um die Funktionsweise und Qualität von Repräsentation präziser bestimmen zu können. Unter „Qualität“ der Repräsentation können dabei allerdings recht verschiedene Dinge verstanden werden; hier bedarf es eines genaueren Blickes auf Repräsentationstheorien und -forschung.
Die Frage nach deskriptiven Disproportionalitäten zwischen Abgeordneten und Bevölkerung, d. h. nach der fehlenden Deckungsgleichheit bezüglich sozialer Charakteristika, wird in der Repräsentationsforschung immer wieder kritisch diskutiert und empirisch untersucht. Zahlreiche Studien belegen, dass Parlamente nicht im naiven Sinne einer Spiegelbildlichkeit repräsentativ sind. Tatsächlich sind im Deutschen Bundestag gut gebildete, männliche, etwa 40 bis 60 Jahre alte und dem öffentlichen Dienst angehörige Abgeordnete überdurchschnittlich präsent, außerdem Menschen aus politiknahen Berufen.3 In der jüngeren Vergangenheit wurden Unterschiede zwischen Parlamentszusammensetzungen und der Bevölkerung vor allem am Beispiel von Frauen4 , ethnischen Minderheiten oder Personen mit Migrationshintergrund5 untersucht.
Statt der Spiegelbildlichkeit sehen komplexere, angemessenere Theorien in der Repräsentation ein Zusammenspiel von Responsivität und politischer Führung6 oder eine „Verantwortlichkeit“ der politischen Akteure, wie Dietrich Herzog in seiner kybernetischen Repräsentationstheorie forderte.7 Vielfach findet allerdings aus dem Komplex der Repräsentation nur der Aspekt der Responsivität, zum Teil reduziert auf die Linkage-Funktion der Abgeordneten, der kommunikativen Verbindung zwischen Parlament und Bürgerschaft, Beachtung.
Uninformierte Kritik an der Erfüllung oder der Qualität der Repräsentationsfunktion, meist in Form von Vorwürfen, beinhaltet oft (als nicht hinterfragte Prämissen) Thesen über die Abgeordnetenrekrutierung. So wird zum Beispiel die vermeintliche Abgehobenheit der Parlamentarier und ihr Desinteresse an „normalen“ Bürgern kritisiert, oder es wird die Vorstellung von einem „Fraktionszwang“ deutlich, der durchgesetzt wird, indem „von oben“ mit dem Entzug der Wiederaufstellung gedroht wird. Damit rückt die Partizipation innerhalb der Parteien bei ihrer wichtigen Funktion der Abgeordnetenrekrutierung in den Mittelpunkt: Wer hat Teil an den Nominierungsentscheidungen, wer sind die „Selektoren“ – seien es informell einflussreiche oder die formell auf den Versammlungen abstimmenden Parteimitglieder (die wir im engeren Sinne als „Elektoren“ bezeichnen)? Der Identität dieser Akteure widmete die Forschung lange Zeit ebenso wenig Aufmerksamkeit wie den Kriterien, die sie für ihre Entscheidung heranziehen, und dem Prozess der Entscheidung selbst.8 Man darf vermuten, dass sich Abgeordnete denjenigen Personen und Gruppen gegenüber, denen sie ihre Aufstellung verdanken, nahe fühlen – sei es in Form von Dankbarkeit, als Teil eines do-ut-des-Geschäftes oder als länger andauernde Abhängigkeit. Auch deswegen ist es demokratietheoretisch für die Parlaments- und Abgeordnetenforschung relevant, die „verantwortlichen“ Akteure, die Selektoren und Elektoren, zu kennen, um so deren Nähe zu den gewählten Abgeordneten genauer untersuchen zu können.
Aber nicht nur der Vorgang der Rekrutierung, sondern auch ihr Ergebnis ist wichtig: Ob die Parlamentsfunktionen erfüllt werden, insbesondere hinsichtlich der politischen Innovation, der gesetzgeberischen Initiative und sachkundigen Beeinflussung beziehungsweise Kontrolle von Entscheidungen des Bundestages sowie der lebendigen Verbindung in die Gesellschaft hängt wesentlich vom Leistungs- und Persönlichkeitsprofil der Abgeordneten ab. Dieser Zusammenhang von Rekrutierung und politischer Leistung wird noch deutlicher mit Blick auf die Exekutive im parlamentarischen Regierungssystem. Nicht aus dem Parlament stammende Minister und Kanzler sind in der Bundesrepublik die große Ausnahme.9 Letztlich wird also mit der Entscheidung über Parlamentsbewerber auch festgelegt, wer eine Chance auf höhere politische Positionen in der Exekutive hat. Da diesen Personen die politische Führung sowohl bei der inhaltlichen Initiative und Gestaltung als auch bei der öffentlichen Vermittlung von Politik vor allem aufgegeben ist, kommt dem Pool, aus dem diese rekrutiert werden, besondere Bedeutung zu. Stellen die Fraktionen und das Parlament als Ganzes nicht mehr sicher oder können sie aufgrund ihrer Zusammensetzung nicht mehr gewährleisten, dass in ihren Reihen spezifische Fähigkeiten sowohl zur inhaltlichen Gestaltung als auch zur Bildung von Mehrheiten und zur kommunikativen Führung gelernt beziehungsweise herausgebildet werden, droht Qualitätsverlust der Politik. Und das Parlament als Instanz der Qualifizierung und Sozialisation von Politikern steht und fällt nun einmal mit dem Ergebnis der Prozesse zur Kandidatenauswahl.
Aus dieser Perspektive dürfte der vielfach und seit hundert Jahren immer wieder konstatierte „Niedergang der Parlamente“ eine seiner Ursachen in mangelhafter Kandidatenauswahl haben.10 Tatsächlich wird in der Diskussion um Entparlamentarisierung beziehungsweise Post-Parlamentarismus erneut argumentiert, dass Parlamente weder die Vielfalt der ausdifferenzierten Interessen angemessen vertreten könnten noch über hinreichenden Sachverstand und genügende fachliche Spezialisierung verfügten, um immer kompliziertere Materien erfolgreich zu regeln. Empirisch fundierte Belege für solcherlei Behauptungen fehlen weitestgehend; zudem bedürfte es theoretisch-normativer Erwägungen, was unter einer angemessenen Interessenvertretung zu verstehen ist. Nichtsdestoweniger zeigt sich an dieser wissenschaftlichen Diskussion ein Unbehagen an der Repräsentationsleistung von Parlamenten, was sich auch in der politischen Realität der letzten Jahre geäußert hat: „Wutbürger“, „Pegida“-Demonstrationen und zweistellige Wahlerfolge der AfD haben der auch schon zuvor diagnostizierten Politik-, Politiker- oder Parteienverdrossenheit wirkmächtig Ausdruck verliehen.
Hinzu kommt eine bereits länger andauernde Entwicklung, die hinsichtlich ihrer Brisanz für das politische System noch gar nicht hinreichend ins Bewusstsein der Öffentlichkeit und auch erst vor kurzem in den Fokus der politikwissenschaftlichen Analyse gedrungen ist: Die im Bundestag vertretenen demokratischen Parteien haben seit 1990 die Hälfte ihrer Mitglieder verloren. Insgesamt zählten sie 2018 noch gut 1,2 Millionen.11
Stellt man in Rechnung, dass nur jedes vierte Parteimitglied aktiv ist12, haben etwa 300.000 Personen nicht nur die Wahlkämpfe inklusive der Programmarbeit auf kommunaler Ebene, für die Landtags-, Bundestags- und Europawahlen vor Ort zu bewerkstelligen, sondern aus ihren Reihen müssen auch die Mandatsträger vom Gemeinderat bis zum Europäischen Parlament rekrutiert werden. Und dies sind (Stand: Februar 2020) 96 für das EP, (mindestens) 598 für den Bundestag, 1.868 für die 16 Landesparlamente und (geschätzt) über 232.000 für die gewählten Vertreter in Gemeinden, Kreisen und Städten. Schon der oberflächliche Vergleich dieser grob geschätzten Werte zeigt, wie eng es personell in den Parteien wird – und insbesondere auf kommunaler Ebene oft schon ist, denn faktisch ist der Bedarf in allen Parteien – auch proportional zu ihrer Mitgliedschaft kalkuliert – nicht gleich, weil die Wahlergebnisse und damit die Zahl der jeweils errungenen Sitze ebenso schwanken wie die regionale Verteilung und die Bereitschaft der Mitglieder zum Engagement.
1. Einschlägige Ergebnisse der Parlaments- und Elitenforschung: Abgeordnete als Ergebnis der Rekrutierung
Abgeordnete wurden vielfach als Teil der Elite von den darauf gerichteten oder in diesem Umfeld entstandenen Untersuchungen mit erfasst, ursprünglich vor allem von Dietrich Herzog.13 Sofern Abgeordnete explizit Gegenstand von Untersuchungen waren, ist für die Bundesrepublik festzustellen, dass der bisher erzielte Forschungsertrag im Hinblick auf die Rekrutierung vor allem auf der Seite des Parlaments, also bei den Ergebnissen des Rekrutierungsprozesses, anzutreffen ist. Solide empirische Befunde liegen vor zur Sozialstruktur von Bundestag, Landesparlamenten und der deutschen Gruppe im Europäischen Parlament, zur Vernetzung der Abgeordneten mit Verbänden und in ihrer Partei, zur „Professionalisierung“ des Bundestages im Sinne sowohl der Entwicklung des Parlamentsmandats zum Beruf als auch der parlamentarischen Funktionserfüllung sowie zum Selbstverständnis der Parlamentarier hinsichtlich der Bedingungen und Umstände ihres politischen Aufstiegs und ihrer Rolle.14 Die Wirkung der Rekrutierung auf die Parlamentsarbeit aber oder gar auf den Policy-Output ist nur selten erfasst worden, nicht zuletzt aufgrund der methodischen Schwierigkeiten beim (Re)konstruieren einer singulären Kausalitätslinie.
Über Abgeordnete, ihre Arbeit im Parlament und im Wahlkreis ist relativ viel bekannt.15 Das kürzlich abgeschlossene CITREP-Projekt (Citizens and Representatives in France and Germany) hat gezeigt, dass die Abgeordneten des Deutschen Bundestages auf vielfältige Weise in ihren Wahlkreisen aktiv sind.16 Ihre Kommunikations- und Vernetzungsanstrengungen sind für demokratische Repräsentation unverzichtbar; ihre Wahlkreisarbeit liefert einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Wahrnehmung der parlamentarischen Kontrollfunktion.17 Den Erwartungen entsprechend, die vor allem aus den institutionellen Anreizen der Kandidatennominierung in Deutschland resultieren, ist die eigene Parteiorganisation vor Ort die wichtigste Bezugsgruppe für die Abgeordneten. Auch dies ist ein Fingerzeig – noch dazu von selbst betroffener Seite, wo die wirklich wichtigen Akteure für die Kandidatennominierung beziehungsweise Wiederwahl zu suchen sind.
Es gibt auch Auszählungen, wie viele Abgeordnete auf welchem Weg ins Parlament gekommen sind. Dietrich Herzog zum Beispiel unterschied ursprünglich Karrierewege nach der Politiknähe (insbesondere der Beteiligung in der Partei) vor Eintritt in die politische Elite.18 Eine Göttinger Forschergruppe um Jens Borchert hat den Beginn der Abgeordnetenkarriere, insbesondere deren Entscheidung zur ersten Kandidatur, unter anderem anhand der biographischen Angaben in den Volkshandbüchern der Landtage untersucht.19 Vier Karrierewege wurden identifiziert, von denen nur die ersten beiden quantitativ als relevant erschienen: der kommunalpolitische, der parteipolitische, der verbandspolitische und jener über Mitarbeiterstellen. Aber mittlerweile dürfte gerade bei den Parlamentsneuzugängen die Verbindung der ersten beiden mit der letztgenannten ein häufiger anzutreffendes Muster darstellen.
Auf die Kandidaten konzentrierten sich in der Bundesrepublik zum ersten Mal seit den sechziger Jahren wieder Hermann Schmitt und Andreas M. Wüst empirisch breit und systematisch.20 In ihrer Befragung aller Kandidaten zur Bundestagswahl 2002 ging es ihnen vor allem um die „Güte der Repräsentation“. Dafür stellten sie die Linkage-Funktion in den Vordergrund und formulierten als Kernfrage, ob Abgeordnete „den Kontakt zu den Wählern verloren“ hätten. Diese operationalisierten sie als Übereinstimmung zwischen Wählern und Kandidaten auf einer eindimensionalen Rechts-Links-Skala und bezüglich der Agenda der vordringlichen Themen. Unabhängige Variablen waren der Weg der Nominierung (Wahlkreis oder Liste), Sieg oder Niederlage bei der Wahl und der Repräsentationsfokus (lokal oder national). Diese Beiträge gehen einen Schritt weiter in Richtung auf die Rekrutierungsprozesse als die Mehrzahl der Untersuchungen, die nur die Abgeordneten zum Gegenstand hatten. Da sie jedoch beim Ergebnis ansetzten, nämlich den Kandidaten, mussten Fragen zum Beispiel hinsichtlich der Identität der Auswählenden offen bleiben. Immerhin liegen damit erstmals umfangreichere Erhebungen, und zwar auch unterlegener Kandidaten, vor.
Diese werden auch berücksichtigt in einem Datensatz, den Philip Manow und Peter Flemming zu allen jemals an einer Bundestagswahl bis 2009 als Kandidaten teilnehmenden Personen erarbeitet haben.21 Hier wie auch in einigen anderen Studien wurde versucht, von sozial-strukturellen Daten der tatsächlich gewählten Abgeordneten beziehungsweise der Kandidaten auf die Kriterien ihrer Auswahl zu schlussfolgern.22 Solche Daten – etwa der steigende Anteil von Hochschulabsolventen oder der hohe Prozentsatz an öffentlich Bediensteten und Männern – können aber nur Hinweise geben auf denkbare Zusammenhänge im Rekrutierungsverfahren, nach denen zu forschen ist. Insbesondere bleibt offen, ob Kriterien der Auswählenden für diese Resultate der Rekrutierung eine Rolle spielen, ob sich überwiegend Kandidaten mit den genannten Eigenschaften zur Verfügung stellen, oder ob es sich um gänzlich unbeabsichtigte Folgen bestimmter Eigenschaften des Rekrutierungsprozesses handelt.
Ein etwas abgewandelter Ansatz bestand darin, die Abgeordneten als Experten für ihre Karrieren zu befragen, insbesondere nach den Kriterien ihrer Auswahl und in einem Fall auch nach den sie unterstützenden Kräften. Aus Patzelts Studie23 lässt sich entnehmen, dass die Mitglieder des Bundestages vorangegangene Berufserfahrung, persönliche Integrität, Responsivität sowie Führungsfähigkeit, Fachkompetenz, Parteiverankerung, kommunalpolitische Erfahrungen und Öffentlichkeitswirksamkeit in dieser Reihenfolge für die wichtigsten Merkmale einer Abgeordnetenkarriere halten. Die Interpretation dieser Daten ist insofern schwierig, als unklar bleiben muss, wie stark sozial erwünschte Antworten, Selbstüberschätzung oder auch Bescheidenheit eine Rolle spielen, und ob die Abgeordneten mit ihrer notwendig singulären Erfahrung tatsächlich als Experten befragt werden können.
Die soweit vorliegende Forschung steuerte also eine Reihe von Erkenntnissen zur Rekrutierung der Bundestagsabgeordneten bei, gab Impulse und warf weitere Fragen dazu auf; umfassend und systematisch wurde aber nicht untersucht, wie Parlamentarier zu ihrer Kandidatur kamen und wer sie wie und warum ausgewählt hat.
2. Befunde der Rekrutierungsforschung im engeren Sinne
Die Prozesse, die Beteiligten und die Selektionskriterien bei der Kandidatenaufstellung wurden zuletzt für die Bundestagswahl 1965 umfassender herausgearbeitet. Bodo Zeuners 1970 publizierte Studie präsentierte auf Grundlage eingehender empirischer Forschung interessante Fakten und Auffälligkeiten für den Rekrutierungsprozess zur Bundestagswahl 1965 und stellte erste Vermutungen über ursächliche Zusammenhänge an. Eine Theorie legte er nicht vor. Seine Methodik bleibt weitgehend unklar und lässt ein zumindest nicht völlig systematisches Vorgehen vermuten. Auch beschränkte er sich auf ausgewählte, nämlich zwischen mehreren Bewerbern einer Partei offen umstrittene Wahlkreise. Seine Studie ist daher weder in theoretischer noch in methodischer Hinsicht als Vorbild geeignet, wohl aber sind seine Ergebnisse als Thesen zu überprüfen und – noch wichtiger: Es lassen sich aus seiner Arbeit Hinweise gewinnen, wer und was genau zu untersuchen ist.24 Heino Kaack legte danach eine ex-ante-Untersuchung der Bundestagswahl von 1969 vor, verzichtete dabei aber ganz auf Quellenangaben und fasste offenbar das zusammen, was der Presse entnommen werden konnte.25 Außerdem gibt es aus den 50er-, 60er- und 70er-Jahren einige Fallstudien, in denen spezielle Fragen aufgegriffen (z. B. das Experiment mit Mitgliederbefragungen bzw. Urwahlen in Bezirksverbänden der CDU26 ; die Rolle der lokalen Presse bei der Kandidatenkür27; die Junge Union als Weg in die politische Karriere28) oder einzelne Bundesländer untersucht wurden.29 Für einen Großteil dieser regional angelegten Rekrutierungsstudien gilt, dass sie in ihrer Fragestellung und Methodik hinter Zeuner zurückbleiben.
Nach Zeuners und Kaacks Arbeiten waren lange Zeit lediglich zwei Aufsätze zu verzeichnen30, die sich in englischsprachigen Sammelbänden an ein internationales Publikum richteten und die Frage, wer wie Kandidaten auswählt, nur überblicksartig behandelten. Sie griffen für Fakten und Daten hauptsächlich auf Zeuner, also auf das Bundestagswahljahr 1965, zurück.31 Ansonsten stand wieder die Analyse der soziostrukturellen Eigenschaften der Abgeordneten und Kandidaten im Vordergrund. Bedingungen und Prozesse der Auswahl, die Akteure und ihre Motive wie auch die individuellen Beweggründe und Ressourcen der Kandidaten blieben ausgeblendet. In Ermangelung neuerer empirischer Erhebungen mussten sich die Autoren mit impressionistischer Evidenz aus Zeitungen begnügen.
Insgesamt wird in den beiden genannten Sammelbänden32 vor allem versucht, eine statistische Beziehung zwischen einigen Makrovariablen, wie etwa dem Wahlsystem, und der Rekrutierung, gemessen an den Eigenschaften von Abgeordneten, herzustellen. Da aber die Erhebung und Analyse der Rekrutierungsverfahren selbst noch kaum begonnen hatte, konnten die statistischen Zusammenhänge zunächst nur Hinweise sein.33
In theoretischer (und komparativer) Hinsicht leistete die internationale Forschung einen Beitrag. Hierbei drangen Pippa Norris und Joni Lovenduski am weitesten vor. Sie legten ein Kategoriensystem (wenn auch keine Theorie im Sinne aufeinander bezogener Hypothesen) vor, das ursprünglich ihre eigene umfassende empirische Forschung zu Großbritannien im Wahljahr 1992 anleitete, in der sie gut 1.600 Teilnehmer an Nominierungsveranstaltungen sowie etwa 1.300 potentielle Parlamentskandidaten, die Aspiranten, befragten.34 Grundlegend in ihrem Konzept war die Unterscheidung zwischen Ursachen und Folgen der Rekrutierung, auf der jene zwischen Angebots- und Nachfrageseite sowie zwischen den verschiedenen Systemen, die die Rekrutierung beeinflussen, aufbaute.
Dieses „Marktmodell“ fand Eingang in die deutschsprachige Rekrutierungsforschung, wobei seine Bestandteile jedoch unterschiedlich konzeptualisiert wurden. So bilden in einer Studie über die Kandidatenaufstellung zur Bundestagswahl 2002 die Interessenten einer Kandidatur das Angebot, während die Nachfrage von den an der Nominierung mitwirkenden Akteuren in den Parteien, insbesondere aktive Parteimitglieder, Delegierte und Vorstände, ausgeht, die auch Wünsche und Vorstellungen ihrer Wähler antizipieren.35 Demgegenüber wurde in einer Studie über die deutschen Parteien zur Europawahl 2009 das Angebot an Listenplätzen, ausdifferenziert nach der Wahrscheinlichkeit des Parlamentseinzugs, von den eine Nominierung anstrebenden Personen nachgefragt.36 Zusammengeführt werden Angebot und Nachfrage in jenem Modell auf einer Auswahldimension, auf der einerseits die nominell und andererseits die faktisch selektierenden individuellen und kollektiven Akteure angesiedelt sind. Sie lassen sich bei ihren Entscheidungen von divergierenden Selektionsprämissen leiten, die vereinfacht dargestellt in die Partei hineinwirken, sich an der Wählerschaft orientieren oder aber dem eigenen Machtstreben untergeordnet sind.
In international ausgerichteten Studien zur Aufstellung von Parlamentskandidaten wurde die Rekrutierungsforschung konzeptionell und methodisch weiterentwickelt.37 Allerdings konzentrierten sich diese Analyseinstrumente auf den „sichtbaren“ Teil der Auswahl, der „unsichtbare“ bzw. informale blieb verschlossen, obwohl er doch oftmals der eigentlich entscheidende Part ist. Zukünftiger Forschungsbedarf – theoretisch, konzeptionell wie auch empirisch – ließ sich somit zum bisher weithin stiefmütterlich behandelten informalen Vorentscheidungsbereich ausmachen. Immerhin konnten mit den Kriterienpaaren „zentral“ vs. „dezentral“ oder „inklusiv“ vs. „exklusiv“ quantifizierbare Aussagen über den offiziellen Ort und Teilnehmerkreis einer Kandidatenaufstellung getroffen werden, was einen Vergleich zwischen Staaten oder Parteien und deren jeweiligen regionalen Untergliederungen sowie die Untersuchung systemischer Rahmenbedingungen als Einflussfaktoren eröffnete.
Die Kriterien „zentral“ vs. „dezentral“ und „inklusiv“ vs. „exklusiv“ benutzte auch Marion Reiser in ihrer Fallstudie zur Kandidatenaufstellung bei der Bundestagswahl 2009.38 Dabei wurden in ausgewählten Wahlkreisen und Landesverbänden durch leitfadengestützte Gespräche und Beobachtungen von Aufstellungsversammlungen Einsichten Zeuners bestätigt, was – inzwischen sind fast fünf Jahrzehnte vergangen – für eine erstaunlich hohe Stabilität der innerparteilichen Nominierungsverfahren spricht. Daran anschließend und in Übereinstimmung mit Benjamin Höhnes vor allem sekundäranalytischen Querschnittdaten39 befand auch Klaus Detterbeck40, dass die Rekrutierungsmechanismen der Parteien nach wie vor (überraschend) stabil sind. Die lokalen und regionalen Parteieliten fungieren weiterhin als „vital gatekeepers“41.
Die zentrale Stellung der Kreisvorsitzenden im Prozess der Kandidatenaufstellung untermauerte auch Christian Steg42 in seiner qualitativen und beobachtenden, allerdings nur die CDU und SPD in Baden-Württemberg einbeziehenden Studie, mit der er Erkenntnisse über die Phase der Vorentscheidung bei der Kandidatennominierung zutage förderte. Den Landesvorständen wiederum obliegt es, im Einvernehmen mit den Kreisen beziehungsweise Bezirken ausgewogene Landeslisten zu erstellen, die relevante innerparteiliche Gruppierungen und Ausgleichsmerkmale berücksichtigen.43 Durch eine solche Gestaltung der Listen kann die Partei besser als auf der Wahlkreisebene die Zusammensetzung der künftigen Parlamentsfraktion beeinflussen und auch Aspekte deskriptiver Repräsentation einfließen lassen. Auf auf dieser Ebene der Kandidatenaufstellung gibt es anscheinend keine nennenswerten prozeduralen Veränderungen in den letzten Jahrzehnten. Dieser Eindruck kann aber mangels umfassender empirischer Studien in der Vergangenheit und verlässlicher Längsschnittdaten nicht präzise belegt werden, so plausibel er auch zeitgenössischen Beobachtern erscheint.
Zudem werden nach wie vor in erster Linie Kandidaten nominiert, die die sogenannte Ochsentour44 durchlaufen bzw. „parteipolitisches Kapital akkumuliert“45 haben. Dies stellten auch Michael Edinger46 und Tamaki Ohmura u. a.47 heraus. Während Edinger sich mit der Frage beschäftigte, ob die Abgeordneten in Deutschland eine Art Korpsgeist entwickelt haben, der auch durch gemeinsame Muster der Rekrutierung bedingt ist, bildeten Ohmura u.a. mithilfe einer Sequenzanalyse vorheriger Parteiaktivitäten von Bundestagsabgeordneten Parteikarrieretypen. Die meisten Abgeordneten sind entweder „Party Animals“, die frühzeitig in die Partei eingetreten sind und dort vor allem in der Jugendorganisation Karriere gemacht haben, oder „Local Heroes“, die vor ihrem Mandat auf lokaler Ebene Vorstandsposten besetzt haben.48 Nach wie vor schaffen nur wenige Abgeordnete, die als Seiteneinsteiger nicht auf Parteikarrieren verweisen können, den Sprung in den Bundestag und sind dort, was die Besetzung von Posten und Ämtern anbelangt, weniger erfolgreich als diejenigen, die die klassische Ochsentour absolviert haben.49
3. Wandel im Verfahren der Aufstellung von Parlamentsbewerbern
Neben der hinsichtlich mancher Aspekte vorgefundenen hohen Stabilität lassen sich aber auch Wandlungserscheinungen im Nominierungsverfahren beobachten. Eine Änderung fällt bei den Aufstellungsergebnissen besonders ins Auge: Innerparteiliche Quotenregelungen haben seit Zeuners Zeiten den Frauenanteil unter den Abgeordneten ansteigen lassen, und zwar von 6,9 Prozent im 1965 gewählten 5. Bundestag auf 30,9 Prozent in der gegenwärtigen 19. Wahlperiode (Höchststand: 36,5 Prozent im 18. Bundestag). Dieser Anteil entspricht in etwa dem Anteil der Kandidatinnen: Unter den 2.516 Wahlbewerbern zum Deutschen Bundestag befanden sich im Jahre 2017 809 Frauen (32,2 Prozent).50 Generell haben sich die soziostrukturellen Daten der Mitglieder des Bundestages aber von Wahl zu Wahl nur geringfügig verändert. So entstammen Abgeordnete schon seit Längerem zunehmend politiknahen Berufsfeldern, d.h. zum Beispiel Parlamentsfraktionen und deren Mitarbeiterstäben.51
Eine weitere Wandlungserscheinung wird nach vorliegenden empirischen Befunden in der stärkeren Einbeziehung der Parteibasis gesehen. International wird ein Trend zu inklusiven Kandidatenaufstellungen ausgemacht, eingebettet in einen Diskurs zur innerparteilichen Demokratiequalität.52 Für die Kandidatenaufstellung zum Bundestag weisen Analysen in dieselbe Richtung; sie zeigen zumindest, dass für die Aufstellung der Kandidaten immer mehr Mitglieder- anstelle von Delegiertenversammlungen veranstaltet werden.53 Nach Suzanne S. Schüttemeyer und Roland Sturm führten „gestiegene Ansprüche und verändertes Verhalten der Parteimitglieder sowie die (erneut) einsetzende Diskussion um Parteireformen zur – dringend benötigten – Vergrößerung der Mitgliedschaft […] dazu, dass mehr und mehr Landes- und Kreis- beziehungsweise Unterbezirksverbände sich dazu entschlossen, die Verfahren der Kandidatenaufstellung zu öffnen“54. Demgegenüber sah Marion Reiser auf Grundlage der von ihr vor der Wahl zum 17. Bundestag erhobenen Daten keine Hinweise auf mehr Partizipationsmöglichkeiten: „Analysiert man die Kandidatenaufstellung für die Bundestagswahl 2009, lässt sich ein grundsätzlicher Trend [jedoch] nicht bestätigen.“55
Alle hier knapp skizzierten Befunde, die mehr oder minder direkt mit der Aufstellung der Parlamentsbewerber in Verbindung stehen, geben aufschlussreiche Informationen, aber eben nur über Teilaspekte des Verfahrens und seiner Ergebnisse. Es war also an der Zeit, die Nominierung von Kandidaten für den Deutschen Bundestag systematisch und so umfassend wie möglich zu untersuchen.
4. Die Studie des Instituts für Parlamentarismusforschung (IParl) zur Kandidatenaufstellung vor der Bundestagswahl 2017
Aus dem skizzierten Forschungsstand wurden für die Studie des Instituts für Parlamentarismusforschung (IParl) die folgenden untersuchungsleitenden Fragen entwickelt: Wer nominiert in den Parteien die Kandidaten für den Bundestag, wer beeinflusst – sei es formell, sei es informell – die Personalentscheidungen? Welche Verfahren werden dafür angewandt, welche Regeln gelten dabei? Wer tritt für eine Kandidatur mit welcher Motivation an? Welche Beweggründe sind bei den Entscheidungen für oder gegen jemanden ausschlaggebend? Wie beurteilen die Parteimitglieder selbst die Art und Weise ihrer Personalauswahl?
Zwischen September 2016 und Juli 2017 wurden insgesamt 166 Aufstellungsversammlungen – 112 in Wahlkreisen und 54 auf Landesebene – in der gesamten Bundesrepublik besucht. 19.785 Mitglieder von CDU, SPD, CSU, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, FDP und AfD wurden mit standardisierten Fragebögen durch das Berliner Meinungsforschungsinstitut policy matters im Auftrag des IParl in 89 zufällig ausgewählten Wahlkreisen und 48 zufällig ausgewählten Landesverbänden befragt.56 Die Rücklaufquote betrug 51 Prozent. Außerdem wurden 123 Versammlungen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des IParl wissenschaftlich beobachtet, 425 teilstrukturierte Leitfadeninterviews bzw. Hintergrundgespräche geführt, die Satzungen der Parteien und Medienberichte ausgewertet.57 Ausgewählte Ergebnisse der Studie sind in sechs weiteren Beiträgen in Heft 1/2020 der ZParl zu finden (siehe Infobox).
Angesichts der Vehemenz, mit der in jüngerer Zeit Forderungen nach mehr Partizipationsmöglichkeiten der Bürger vorgetragen werden und im Lichte der obigen Ausführungen zur Bedeutung der innerparteilichen Demokratie und den drohenden Konsequenzen des Mitgliederschwunds in den Parteien sollen im Folgenden die Teilnahmeangebote und ihre tatsächliche Nutzung in den Verfahren zur Kandidatenaufstellung mithilfe der aktuellen Daten aus dem IParl-Projekt untersucht werden. Dabei wird es nicht zuletzt darum gehen, den trügerischen Gehalt des trendigen Begriffs der Inklusion zu erhellen. Abgeleitet von dem englischen Wort „inclusiveness“ hat auch die synonym verwendete „Inklusivität“ in die Parteien- und Partizipationsforschung Eingang gefunden. Laut Duden existiert dieser Begriff im Deutschen jedoch nicht. Daher wird im Folgenden der auch für den gesellschaftlichen Einschluss von unterschiedlichen (Rand-)gruppen gängige Begriff der Inklusion verwendet, um den Anteil der Elektoren an der Gesamtmitgliedschaft der Partei zu bezeichnen.
5. Partizipation und Inklusion der Parteimitglieder bei der Kandidatenauswahl
Eine Bestandsaufnahme der Satzungen von den im 19. Bundestag vertretenen Parteien ergab, dass in nur drei Landesverbänden der CDU, in sechs der SPD und in einem der FDP vorgeschrieben ist, dass eine Delegiertenversammlung die Kandidatenaufstellung im Wahlkreis vornimmt. Mitgliederversammlungen sind in fünf Landesverbänden der CDU, bei der Linken in Brandenburg und weit überwiegend in den Landesverbänden der FDP ausdrücklich vorgeschrieben, ansonsten ist es den jeweiligen Parteigliederungen auf Kreisebene freigestellt, welches Verfahren angewendet wird.58
Schon in einer Pilotstudie zur Bundestagswahl 2002, bei der alle Direktkandidaten der CDU, CSU, SPD sowie der PDS in den neuen Bundesländern befragt worden waren, war der Trend zu einer Öffnung der Aufstellungsverfahren beobachtet worden: So wurden bei der CDU und der PDS 60 Prozent, der SPD 14 Prozent und einzig bei der CSU keine der untersuchten Wahlkreisveranstaltungen als Mitgliederversammlungen abgehalten.59 Im Vorfeld der Bundestagswahl 2017 hat sich diese Entwicklung fortgesetzt: Bei der CDU entschied man sich in circa zwei Drittel und bei der SPD in einem Drittel aller Wahlkreise für Mitgliederversammlungen. Vor allem in den kleinen Parteien stellen Delegiertenversammlungen die große Ausnahme dar, wobei die Grünen und die AfD, soweit bekannt, immer Mitgliederversammlungen abhielten und auch die Linke und die FDP nur wenige Ausnahmen davon machten. Lediglich die CSU führte erneut keine Mitgliederversammlungen durch, obwohl ihre Satzung durchaus die Öffnung für die gesamte Mitgliedschaft zuließe.60
Auch bei den Landeslistennominierungen, deren Verfahren im Gegensatz zur Kreisebene in aller Regel in den Satzungen festgeschrieben ist61, gab es im Vergleich zu 2002 eine leichte Tendenz zu mehr Mitgliederversammlungen. Neben Bündnis 90/Die Grünen, die ihre Mitglieder nach wie vor in den Stadtstaaten und in Hessen sowie die Linke in Bremen und im Saarland über die Listen entscheiden ließen, veranstalteten nun auch die AfD (außer in Nordrhein-Westfalen und Sachsen) sowie die FDP in Hamburg Landesmitgliederversammlungen.
Die in der Tendenz häufigere Durchführung von Mitgliederversammlungen lässt jedoch noch keinen unmittelbaren Rückschluss auf die Anzahl der auswählenden Parteimitglieder zu. Zwar kann man vermuten, dass auf Mitgliederversammlungen mehr Parteimitglieder anwesend sind, diese Versammlungen somit „partizipativer“ sind, da an ihnen mehr Parteimitglieder teilnehmen können als auf Delegiertenversammlungen; dies bedeutet aber keinesfalls, dass sie es auch wirklich tun. So zeigt sich beispielsweise für die zwölf vom IParl zufällig ausgewählten Wahlkreisnominierungen der CDU, dass durchschnittlich mehr Stimmberechtigte auf Mitgliederversammlungen über die Direktkandidaten entschieden (146) als auf Delegiertenversammlungen (90), bei den 15 untersuchten Wahlkreisnominierungen der SPD beteiligten sich im Durchschnitt jedoch mehr auswählende Parteimitglieder an Delegiertenversammlungen (90) als an Mitgliederversammlungen (60).62
5.1. Die Beteiligung der Parteimitglieder und Grenzen des Parteienvergleichs
Alle Parteimitglieder, die auf Delegierten- oder Mitgliederversammlungen von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen, bilden zusammen das Elektorat. Die Anzahl der „Elektoren“ unterscheidet sich dabei erheblich zwischen Wahlkreis- und Landesebene. Sie kann zwar nicht exakt ermittelt werden, da eine Vollerhebung nicht vorliegt; auf Basis der vom IParl durchgeführten Erhebungen können Schätzungen jedoch einen fundierten Einblick in den Umfang der Beteiligung geben. Es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Umfang darzustellen: (1) anhand der tatsächlich auf einer Aufstellungsversammlung anwesenden Mitgliederzahl (Partizipation) und (2) anhand der tatsächlich anwesenden Mitgliederzahl im Verhältnis zur Gesamtmitgliederzahl der Partei (Inklusion bzw. Inklusionsrate). In den folgenden Tabellen werden beide Werte angegeben. Insgesamt nahmen vor der Bundestagswahl 2017 knapp 95.000 Personen, das heißt 7,8 Prozent aller Mitglieder der untersuchten Parteien, an der Auswahl der Direktkandidaten teil (siehe Tabelle 1).63

An den Wahlen der Landeslisten beteiligten sich der Schätzung zufolge circa 21.000 Personen, also rund 1,8 Prozent aller Mitglieder der im 19. Bundestag vertretenen Parteien (siehe Tabelle 2).64 Daraus kann allerdings nicht geschlossen werden, dass insgesamt etwa 116.000 Parteimitglieder die Bundestagskandidaten auswählten. Die meisten der Mitglieder, die über die Landesliste abstimmten, nominierten auch den Direktkandidaten in ihrem Wahlkreis, so dass die Gesamtzahl der Elektoren realistisch betrachtet kaum über 95.000 hinausgehen dürfte.

Auffällig ist, dass die durchschnittliche Anzahl der Elektoren sowohl auf Wahlkreis- als auch auf Landesebene – zum Teil stark – von Partei zu Partei variiert. In den Wahlkreisen zählen CDU, CSU und SPD im Durchschnitt die mit Abstand meisten Stimmberechtigten pro Aufstellungsversammlung. Ein Erklärungsansatz ist, dass diese Parteien die meisten Wahlkreise gewinnen und sich in vielen ihrer – wenngleich bei der SPD schwindenden – Hochburgen sicher sein können, dass ihr Kandidat direkt in den Bundestag gewählt wird.65 Aus diesem Grund könnte der Nominierung dort mehr Gewicht zugeschrieben werden als in den kleineren Parteien. Dieser Argumentationszusammenhang wird jedoch durch die Tatsache entkräftet, dass die erfolgreiche Kandidatur in einem Wahlkreis eine nahezu zwingende Voraussetzung für einen aussichtsreichen Listenplatz ist.66 Demnach gaben in der IParl-Untersuchung 63 Prozent aller bei den Landeslistennominierungen befragten Elektoren an, dass eine erfolgreiche Wahlkreiskandidatur des Bewerbers für ihre Auswahlentscheidung „sehr wichtig“ oder „wichtig“ war. Für nur 11,2 Prozent der Auswählenden war eine Wahlkreisnominierung „gar nicht wichtig“. Folglich sind auch Wahlkreisnominierungen, bei denen der Kandidat keine Aussicht auf ein Direktmandat hat, von großer Bedeutung, da sie die Chance auf einen aussichtsreichen Listenplatz wesentlich bestimmen.
In der Tat liegt der offenkundigste Grund für die weitaus höheren Elektorenzahlen bei den Wahlkreisnominierungen von CDU, CSU und SPD gegenüber den kleineren Parteien in den unterschiedlichen Mitgliederzahlen begründet: Mitgliederstärkere Parteien können natürlich mehr Elektoren in den Nominierungsprozess einbinden als mitgliederschwächere. So kam es beispielsweise vor, dass die CDU in ihrer Hochburg Cloppenburg-Vechta mit 7.300 Parteimitgliedern über 1.800 Stimmberechtigte für die kompetitive Mitgliederversammlung mobilisieren konnte. Zum Vergleich: Sowohl die Grünen als auch die Linken zählten in Cloppenburg-Vechta keine 100 Mitglieder.67 Demnach unterliegt eine direkte Gegenüberstellung der durchschnittlichen Elektorenzahlen zwangsläufig Verzerrungseffekten, da mancherorts gar nicht so viele Mitglieder am Nominierungsprozess partizipieren können wie in den Volks- bzw. Großparteien.
Für eine adäquate Einordnung der Beteiligung scheint es somit sinnvoll zu sein, das Inklusionsniveau der Veranstaltungen, d.h. die (geschätzte) Elektorenzahl in Relation zu der Gesamtzahl der Parteimitglieder, heranzuziehen (siehe vorletzte Zeile in Tabelle 1 und 2). Dabei zeigt sich, dass die kleineren Parteien sowohl im Wahlkreis als auch auf Landesebene die inklusiveren Aufstellungsversammlungen durchführten: Im Wahlkreis nahm mehr als jedes zehnte – im Falle der AfD sogar mehr als jedes vierte – Parteimitglied an den Nominierungen teil. Bei den Aufstellungen der Landeslisten bewegte sich die prozentuale Beteiligung bei den kleineren Parteien zwischen 3,6 Prozent (Die Linke) und 19,9 Prozent (AfD)68 der Gesamtmitgliedschaft, während sich an den Listenaufstellungen von CDU, CSU und SPD weniger als ein Prozent aller Mitglieder beteiligten.
Doch auch bei diesem Vergleich ist Vorsicht geboten – und zwar nicht nur, weil die AfD ihre Listen hauptsächlich auf Mitgliederversammlungen aufstellen ließ und sich somit per se mehr Parteimitglieder an der Auswahlentscheidung beteiligen konnten als auf Delegiertenversammlungen, sondern abermals aufgrund von Verzerrungseffekten, die dem Ungleichgewicht der Mitgliederzahlen geschuldet sind – in diesem Fall zu Lasten der mitgliederstärkeren Parteien. Auch hierzu ein Beispiel: Die AfD-Landesliste in Bremen wurde von 40 Mitgliedern aufgestellt. Dies ist eine vergleichsweise geringe Zahl an Elektoren. Aufgrund der niedrigen AfD-Parteimitgliederzahl in Bremen (148) entspricht dies jedoch über 25 Prozent aller Mitglieder, so dass diese Listenveranstaltung als besonders inklusiv zu bewerten ist. Um dieselbe Inklusionsrate zu erreichen, müssten an der dortigen Listenaufstellung der CDU über 550, bei der SPD sogar über 1.000 Mitglieder teilnehmen. Rein theoretisch könnten solche Beteiligungsraten zwar erreicht werden, politikpraktisch setzt dies allerdings nicht nur einen Verfahrenswechsel hin zu Mitgliederversammlungen bei der Bremer CDU- beziehungsweise SPD-Listennominierung voraus, sondern erfordert auch eine erhebliche Mitgliedermobilisierung sowie einen großen organisatorischen Mehraufwand.
So ist der Versuch, durch die Berechnung der Inklusion von Nominierungsveranstaltungen eine analytisch gehaltvolle Gegenüberstellung der auf den Aufstellungsversammlungen votierenden Parteimitglieder zu gewährleisten, zwar prima vista nachvollziehbar. Aus solchen Inklusionsraten aber direkt Rückschlüsse auf innerparteiliche Demokratie zu ziehen – also Partei A für „demokratischer“ als Partei B zu erklären – verbietet sich, denn mitgliederstärkere Parteien müssen mehr zeitliche, organisatorische und demnach auch finanzielle Ressourcen einsetzen, um eine vergleichbare Inklusion zu erzielen wie mitgliederschwächere Parteien. Dies zeigt, mit welcher Vorsicht Inklusionsraten zu interpretieren sind.69
Vor diesem Hintergrund lohnt sich sowohl die Gegenüberstellung der Elektorenzahlen als auch die Inklusionsberechnung von Nominierungsveranstaltungen nur dann, wenn ausschließlich Parteien etwa gleicher Mitgliedschaftsgröße in den Blick genommen werden. Ein solcher Vergleich ist zwischen CDU und SPD sowie zwischen FDP, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke möglich.70 Im ersten Fall zeigt sich, dass bei der CDU die Aufstellungsversammlungen im Wahlkreis besser besucht waren und einen höheren Anteil der jeweiligen Mitgliedschaft mobilisierten, also partizipativer und inklusiver waren als bei der SPD. Die bei den Christdemokraten häufiger genutzten Mitgliederverfahren können einen Grund für diesen Befund darstellen. Allerdings ist dieser nicht zwingend, da, wie erwähnt, bei den vom IParl zufällig ausgewählten Wahlkreisaufstellungen der SPD im Durchschnitt mehr auswählende Parteimitglieder auf Delegierten- als auf Mitgliederversammlungen zugegen waren. Auf Landesebene zeichnet sich ein gegensätzliches Bild ab: Hier nahmen mehr Elektoren an den SPD-Listennominierungen teil als an jenen der CDU, was wohl vor allem daran lag, dass die Sozialdemokraten öfter feste anstatt mitgliederbasierte Delegiertenschlüssel zur Veranschlagung der Delegiertenzahlen heranziehen.71
In der Gegenüberstellung von FDP, Grünen und Linken waren die Nominierungs-veranstaltungen der Liberalen besonders partizipativ und inklusiv. Über die FDP-Direktkandidaten stimmten 17,8 Prozent aller Mitglieder ab, bei den Grünen waren es 15,0 und bei der Linken 12,2 Prozent. An den Landeslistennominierungen der Freien Demokraten nahmen durchschnittlich fast doppelt so viele Elektoren teil wie bei den Bündnisgrünen und Linken. Da die Wahlkreisnominierungen in allen drei Parteien hauptsächlich von Mitgliedern und die Bundestagslisten vornehmlich von Delegierten aufgestellt wurden, können diese Beteiligungsunterschiede nicht auf unterschiedliche Aufstellungsverfahren zurückgeführt werden. Vielmehr ist davon auszugehen, dass der FDP vor dem Hintergrund des erstrebten Wiedereinzugs in den Bundestag besonders daran gelegen war, ihre Mitglieder zu mobilisieren. Auf den hauptsächlich als Delegiertenversammlungen abgehaltenen Listennominierungen wurde die höhere Beteiligungsrate durch vergleichsweise hoch angesetzte Delegiertenzahlen möglich, die ebenfalls auf festen Schlüsseln basieren.72 Das Beteiligungsangebot der FDP wurde von ihren Mitgliedern wohl nicht zuletzt deshalb genutzt, weil nach vier Jahren außerparlamentarischer Opposition viele neue Kandidaten gefunden werden mussten, was den Wahlausgang offener und die Aufstellungsversammlungen höchstwahrscheinlich interessanter werden ließ.73
Festgestellt werden kann demnach, dass vor allem bei den Landeslistennominierungen feste Delegiertenschlüssel zu einem größeren Elektorat führten. Natürlich können diese nur zu mehr Beteiligung führen, insofern die Delegierten ihr Mandat auch ausüben. Drei Gründe sprechen jedoch dafür: Ein Parteimitglied, das Delegierter sein möchte, muss erstens von seiner Parteigliederung dazu gewählt werden, was bedeutet, dass es grundsätzlich zur Ausübung dieser Funktion gewillt ist. Zweitens werden für den Fall, dass ein Delegierter aus gesundheitlichen oder zeitlichen Gründen nicht an der Nominierungsveranstaltung im Wahlkreis oder auf Landesebene teilnehmen kann, in der Regel Ersatzdelegierte gewählt, die im Notfall einspringen, und drittens erhöht die gängige parteiinterne Durchsage der anwesenden Delegiertenanzahl nach Kreisverbänden den Druck, die lokale Gliederung auf dem Nominierungsparteitag angemessen zu vertreten.
Vorschnell wäre es jedoch, partizipativere und inklusivere Aufstellungsversammlungen automatisch für demokratischer zu halten und ihnen einen demokratisierenden Effekt auf ihre Ergebnisse zuzuschreiben. So kann eine Aufstellungsversammlung, bei der 100 Elektoren über einen Kandidaten entscheiden, in gleichem Maße demokratisch sein wie eine Nominierung, an der sich 200 Elektoren beteiligen; und die Auswahlentscheidung, über die ein Prozent aller Mitglieder abstimmt, kann genauso demokratisch sein wie jene, über die fünf Prozent formal entscheiden. Dabei bedeutet „demokratisch“ hier nicht nur, dass auch kleinere oder exklusivere Veranstaltungen den förmlichen Grundsätzen des Wahlrechts entsprechen. Vielmehr sollte als normative Folie für den „Demokratiegehalt“ von Verfahren der Kandidatennominierung verstanden werden, dass sich der Wille der Partei auf diesen Aufstellungsversammlungen und in ihren Resultaten widerspiegelt, es sich also um einen innerparteilichen Repräsentations- und Legitimationsprozess handelt. Dies gilt für Delegierten- wie für Mitgliederversammlungen, für wenige wie für viele Teilnehmer (solange nicht tatsächlich sämtliche Parteiangehörige der jeweiligen Organisationsebene mitwirken).
Unter dieser Perspektive sind also partizipativere und inklusivere Verfahren hinsichtlich der demokratischen Legitimität ihrer Ergebnisse nicht per se den beteiligungsschwächeren und exklusiveren überlegen. So erbringen zum Beispiel Delegierte, die sich im Vorfeld einer Aufstellungsversammlung ein Meinungsbild in ihrem Orts- oder Kreisverband einholen und auf dessen Basis ihre Auswahlentscheidungen abwägen und treffen, eine höhere Repräsentationsleistung als ein einzelnes Parteimitglied, das zwar an der Kandidatenaufstellungsversammlung teilnimmt, sich ansonsten aber nur selten oder gar nicht in innerparteiliche Aktivitäten einbringt. Insofern darf auch bezweifelt werden, dass die Erweiterung der Anzahl an Nominierenden verhindert, dass persönliche Beweggründe als Selektionskriterium fungieren und eine Auswahl nach objektiven Eignungskriterien unterbinden. Zeuner vermutete diesbezüglich Anfang der 1970er Jahre: „Je mehr Personen an der Entscheidung [gemeint ist die Kandidatenauswahl] beteiligt werden, umso geringer wird der Anteil derer, die persönliche Bindungen zu einem der Bewerber haben und daher irrational und im Effekt konfliktfeindlich reagieren.“74 Dagegen steht, dass Personen, die sich dauerhaft und intensiver in ihrer Partei engagieren, also auch wahrscheinlich entsprechend sozialisiert sind, eher auf Basis objektivierter Kriterien ihre Auswahlentscheidung treffen dürften denn aus persönlichen bzw. subjektiven Motiven.
Entgegen diesen repräsentationstheoretisch begründeten Argumenten zeigt die politische Wirklichkeit: Faktisch kann von vermehrter Partizipation und/oder einer höheren Inklusionsrate insofern eine legitimationssteigernde Wirkung ausgehen, als gemeinhin Entscheidungen als umso „demokratischer“ eingeschätzt werden, je breiter die Beteiligung ausfällt, d. h. im Falle von Auswahlentscheidungen neben Parteifunktionären und Mandatsträgern auch Basismitglieder mitwirken. Betrifft dies die Outputseite der Partizipation, sollte auch auf der Inputseite folgender Zusammenhang nicht unterschätzt werden: Politische Beteiligung dient dem normativen Partizipationsverständnis zufolge „auch und insbesondere der Integration in die jeweilige Gemeinschaft wie der (öffentlichen) Identifikation mit und der Manifestation für deren Ziele. Die praktische Erfahrung des (alltäglichen) Zusammenhandelns gewährleistet aber vor allem die notwendige Erziehung zu demokratischem und bürgerschaftlichem Handeln“75. Dies unterstreicht noch einmal, welcher Rang den Parteien und den in ihnen ablaufenden Prozessen der Willensbildung und Entscheidung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Politische Kultur zukommt.
5.2. Sinkende Beteiligung im Spiegel des Mitgliederrückgangs
Vor diesem Hintergrund ist es hinsichtlich der Funktionsfähigkeit von Parlament und Parteien höchst bedenklich, dass die Beteiligung an der Aufstellung von Bundestagskandidaten offenbar rückläufig ist. Die Schätzung auf Basis der Daten aus der Pilotstudie zur Bundestagswahl 2002 ergab, dass seinerzeit allein an den Wahlkreisnominierungen von CDU, CSU und SPD über 114.000 Parteimitglieder teilgenommen hatten (vgl. Tabelle 3).76 Für die Kandidatenaufstellung zur Bundestagswahl 2017 kommen CDU, CSU und SPD auf eine Elektorenzahl von gerade einmal rund 62.000, was innerhalb von 15 Jahren einen Rückgang von über 50.000 Auswählenden in diesen Parteien entspricht. Ein leichter Abwärtstrend lässt sich ebenfalls für die Beteiligung auf Landesebene feststellen: Wurde für die Bundestagswahl 2002 davon ausgegangen, dass insgesamt 17.000 Parteimitglieder die Listenkandidaten ausgewählt haben77 , waren es bei der Kandidatenaufstellung für die Bundestagswahl 2017 – exklusive AfD – nur knapp 16.300 (siehe oben Tabelle 2).

Demnach zeigt sich auch an dieser Stelle, dass eine häufigere Durchführung von Mitgliederversammlungen keinen unmittelbaren Anstieg der Elektorenzahl zur Folge haben muss. So führten, wie eingangs beschrieben, sowohl die CDU als auch die SPD auf Wahlkreisebene im Vergleich zur Bundestags-Kandidatenaufstellung 2002 tendenziell mehr Mitgliederversammlungen durch, die Partizipation an den Nominierungsveranstaltungen ist jedoch gerade in diesen Parteien drastisch gesunken. Die CSU, die auch heute noch am Delegiertenprinzip festhält, verzeichnete hingegen einen Anstieg der Elektorenzahl von über 2.000, da der Delegiertenschlüssel von 2002 zu 2017 von 120 auf 160 Elektoren pro Veranstaltung angehoben wurde.78
Der umfassende Beteiligungsrückgang der die Direktkandidaten auswählenden Parteimitglieder von CDU und SPD ist das naheliegende Resultat eines hinreichend bekannten, aber anscheinend unaufhaltsamen Problems: Seit 1990 haben sich ihre Mitgliederzahlen von seinerzeit fast 2,5 Millionen auf unter eine Million im Jahr 2017 mehr als halbiert.79 Beunruhigender noch: Mithilfe einer Zeitreihenanalyse wurde prognostiziert, dass der Mitgliederschwund beider Parteien fortschreiten und die CDU im Jahr 2030 rund 278.000, die SPD 205.000 Mitglieder zählen wird.80 Vor diesem Hintergrund ist anzunehmen, dass auch die Zahl der aktiven Parteimitglieder weiter zurückgehen wird. Von der Bundestagskandidatenaufstellung 2002 zu 2017 ist die Anzahl der sich aktiv am Aufstellungsprozess Beteiligenden sogar schneller geschrumpft als die Mitgliederzahlen der Parteien: Während diese bei CDU, SPD und CSU innerhalb von 15 Jahren um insgesamt 32,8 Prozent gesunken sind, brach die Zahl der an der Kandidatenaufstellung im Wahlkreis mitwirkenden Parteimitglieder um 46,0 Prozent ein.81 Diese Beobachtung ist ein besonderes Alarmsignal für die Parteien, denn es zeigt, dass sie in den letzten Jahren mehr noch als passive, sogenannte Karteileichen, ihre aktiven Mitglieder verloren haben – und es ist dieser Kreis, aus dem sich wiederum potentielle Kandidaten rekrutieren lassen.
5.3. Einordnung der Befunde und künftige Herausforderungen
Die vorgestellten empirischen Daten sind nicht nur für die Politikwissenschaft, sondern auch für Parteien und Öffentlichkeit von Bedeutung. Demokratien leben von Partizipation, und eine funktionierende parlamentarische Demokratie ist ohne Parteien und die Teilnahme ihrer Mitglieder nicht vorstellbar. Eine praxisorientierte Erforschung der Kandidatenaufstellung sollte deshalb Probleme und Herausforderungen offenlegen, Lösungen anbieten oder wenigstens die sachlichen Grundlagen für solche Lösungen schaffen.
Die Zahl der auf den Versammlungen zur Aufstellung der Bundestagskandidaten anwesenden Elektoren und die Inklusionsrate der Parteimitglieder können Auskunft über die Größenordnung innerparteilicher Beteiligung geben. Ein direkter Parteienvergleich unterliegt – wie gezeigt – aufgrund der unterschiedlichen Mitgliederzahlen Verzerrungseffekten, weshalb nur die Werte von Parteien mit ähnlich vielen Mitgliedern verglichen werden sollten. In diesem Rahmen konnte festgestellt werden, dass die Aufstellungsversammlungen der FDP gegenüber denen von Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke zur Bundestagswahl 2017 partizipativer und inklusiver ausfielen. Dies gilt auch für die Wahlkreisaufstellungsversammlungen der CDU gegenüber denen der SPD und für die Listennominierungen der Sozialdemokraten gegenüber jenen der Christdemokraten. Zwar verbieten sich aus den genannten Gründen schlichte Gleichsetzungen: Partizipativer und inklusiver bedeutet nicht automatisch demokratischer; jedoch kann von partizipativeren Aufstellungsversammlungen und inklusiveren Verfahrensformen eine demokratisierende Wirkung ausgehen – sowohl hinsichtlich der Input- als auch der Outputlegitimation. Es gibt also gute Gründe für die Parteien, höchste Anstrengungen zu unternehmen, einem weiteren Beteiligungsrückgang bei Kandidatennominierungen entgegenzuwirken.
Ohne einen Krisenzustand herbeizureden oder ein pessimistisches Licht auf die Zukunft der parlamentarischen Parteiendemokratie werfen zu wollen, geben die hier vorgelegten Befunde Anlass zur Sorge. Es werden geeignete Kandidaten benötigt, um die Repräsentationsfähigkeit des Parlaments in allen Ausprägungen zu sichern; diese entstammen den Parteien, die insofern Lehr- und Lernorte der Demokratie sein müssen. Um diese Funktion zu erfüllen, brauchen sie ihrerseits Mitglieder, die zur Mitarbeit bereit sind, sich also als Bewerber zur Verfügung stellen und/oder als Elektoren an den Prozessen der Kandidatenaufstellung mitwirken. Letzteres erfordert, sich ein Bild von den Bewerbern zu machen und Freizeit, gegebenenfalls auch finanzielle Mittel zu investieren, um an der Auswahlentscheidung auf den Nominierungsveranstaltungen der Parteien teilzunehmen.
Die Frage ist, wie die Anzahl derer, die einen solchen Beitrag zu leisten bereit sind, erhöht oder zumindest gesichert werden kann. Die Öffnung hin zu mehr Mitgliederversammlungen scheint nach unseren Befunden jedenfalls kein Allheilmittel zu sein. Vielmehr sollten die lokalen beziehungsweise regionalen Parteiführungen bei der Veranstaltung von Mitgliederversammlungen im Wahlkreis oder auf Landesebene sorgsam beobachten, wie viele ihrer Mitglieder sich tatsächlich an der Auswahlentscheidung beteiligen und sich nicht mit dem Angebot der inklusiveren Verfahrensform begnügen. Sinken die Beteiligungszahlen, ist über Gegenmaßnahmen nachzudenken, zum Beispiel ob Delegiertenversammlungen mit einem festen Delegiertenschlüssel nicht geeigneter sind als Mitgliederversammlungen, um die aktive Mitwirkung an der Kandidatenaufstellung (weiterhin) zu gewährleisten. Diese ist unverzichtbar, denn es sind die auswählenden Parteimitglieder, die für die Bürgerinnen und Bürger das personelle Angebot an Kandidaturbewerbern für den Deutschen Bundestag filtern und damit einen wichtigen Beitrag für den Bestand der parlamentarischen Demokratie leisten.
_________________________________
1 Ernst Fraenkel, Die repräsentative und die plebiszitäre Komponente im demokratischen Verfassungsstaat, in: ders., Deutschland und die westlichen Demokratien, Stuttgart u.a. 1974, S. 151.
2 Bodo Zeuner, Kandidatenaufstellung zur Bundestagswahl 1965. Untersuchungen zur innerparteilichen Willensbildung und zur politischen Führungsauslese, Den Haag 1970, S. 4. In diesem Lichte ist die Praxis der Kandidatenaufstellung in demokratischen (!) Parteien anderer europäischer Staaten höchst bemerkenswert: In Frankreich werden die Kandidaten beispielsweise von Nominierungskommissionen der Parteien aufgestellt, die in der Regel aus wenigen Funktionären bestehen. Die Kommission der von Staatspräsident Emmanuel Macron gegründeten Partei La République en Marche hatte zum Beispiel lediglich neun Mitglieder, die im Rahmen gesetzlicher Vorgaben (Parité, non-cumul-des mandats) aus knapp 15.000 Bewerbern 577 Wahlkreiskandidaten auswählten. In der Konservativen Partei des Vereinigten Königreichs wurde bei ihrer Kandidatenauslese zur letzten Unterhauswahl zur Bedingung für die Aufstellung gemacht – laut Pressemitteilungen auf Geheiß von Boris Johnson, dass die Bewerber eine unmissverständliche Zustimmungserklärung zum Brexit unterzeichneten. Zur Letztbestimmung der Kandidaten durch ein Streichrecht des Parteivorsitzenden in Griechenland siehe schon Akritas Kaidatzis, Die Wirklichkeit der innerparteilichen Demokratie in Griechenland, in: ZParl, 30. Jg. (1999), H. 2, S. 472 – 486.
3 Siehe schon Heino Kaack, Wer kommt in den Bundestag? Abgeordnete und Kandidaten 1969, Opladen 1969, und für den gegenwärtigen, 19., Bundestag Melanie Kintz / Malte Cordes, Daten zur Berufsstruktur des Deutschen Bundestages in der 19. Wahlperiode, in: ZParl, 50. Jg. (2019), H. 1, S. 42 – 58; siehe auch Kürschners Volkshandbuch, Deutscher Bundestag, 19. Wahlperiode, Rheinbreitbach 2018, S. 329 – 333.
4 Zum Beispiel Louise K. Davidson-Schmich / Isabelle Kürschner, Stößt die Frauenquote an ihre Grenzen? Eine Untersuchung der Bundestagswahl 2009, in: ZParl, 42. Jg. (2011), H. 1, S. 25 – 34.
5 Zum Beispiel Andreas Wüst / Thomas Saalfeld, Abgeordnete mit Migrationshintergrund im Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland und Schweden: Opportunitäten und Politikschwerpunkte, in: Michael Edinger / Werner J. Patzelt (Hrsg.), Politik als Beruf, PVS-Sonderheft 44, Wiesbaden 2011, S. 312 – 333; Andreas M. Wüst, Immigration into Politics, Immigrant-Origin Candidates and Their Success in the 2013 Bundestag Election, in: German Politics and Society, 32. Jg. (2014), H. 3, S. 1 – 15; ders., Incorporation beyond Cleavages? Parties, Candidates and Germany's Immigrant-Origin Electorate, in: German Politics, 25. Jg. (2016), H. 3, S. 414 – 432; Aimie Bouju, Politische Unterrepräsentation von Menschen mit Migrationshintergrund nach der Bundestagswahl 2017: Die Mitschuld der Parteien? Eine Kurzanalyse für die CDU und SPD, erschienen auf regierungsforschung.de am 29. Oktober 2018, https://regierungsforschung.de/politische-unterrepraesentation-von-menschen-mit-migrationshintergrund-nach-der-bundestagswahl-2017/ (Abruf am 4. März 2020).
6 Vgl. Hanna Fenichel Pitkin, The Concept of Representation, Berkeley 1972; Werner J. Patzelt, Abgeordnete und Repräsentation, Passau 1993.
7 Vgl. Dietrich Herzog, Was heißt und zu welchem Ende studiert man Repräsentation?, in: ders./ Bernhard Weßels (Hrsg.), Konfliktpotentiale und Konsensstrategien. Beiträge zur politischen Soziologie der Bundesrepublik, Opladen 1989, S. 307 – 335.
8 Für EP-Kandidatenaufstellungen sind jedoch sowohl die Zusammensetzung der Elektoren (siehe Benjamin Höhne, Rekrutierung von Abgeordneten des Europäischen Parlaments. Organisation, Akteure und Entscheidungen in Parteien, Opladen 2013, S. 238 – 248) als auch deren Auswahlpräferenzen (ebenda, S. 266 – 299) umfassend dokumentiert und analysiert.
9 Zum Beispiel Jörn Fischer / André Kaiser, Wie gewonnen, so zerronnen? Selektions-und Deselektionsmechanismen in den Karrieren deutscher Bundesminister, in: Michael Edinger / Werner J. Patzelt (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 5), S. 192 – 212.
10 Vgl. Michael Gallagher, Conclusion, in: ders. / Michael Marsh (Hrsg.), Candidate Selection in Comparative Perspective. The Secret Garden of Politics, London / Newbury Park 1988, S. 236 – 283, S. 276.
11 Vgl. Oskar Niedermayer, Parteimitgliedschaften im Jahre 2018, in: ZParl, 49. Jg. (2018), H. 2, S. 385 – 410.
12 Vgl. Tim Spier, Wie aktiv sind die Mitglieder der Parteien?, in: ders. / Marcus Klein / Ulrich von Alemann / Hanna Hoffmann / Annika Laux / Alexandra Nonnenmacher / Katharina Rohrbach (Hrsg.), Parteimitglieder in Deutschland, Wiesbaden 2011, S. 97 – 119.
13 Dietrich Herzog, Politische Führungsgruppen. Probleme und Ergebnisse der modernen Elitenforschung, Darmstadt 1982; ders. / Hilke Rebenstorf / Camilla Werner / Bernhard Weßels, Abgeordnete und Bürger. Ergebnisse einer Befragung der Mitglieder des 11. Deutschen Bundestags und der Bevölkerung, Opladen 1990; Hans-Georg Wehling (Hrsg.), Eliten in der Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart 1990; Dietrich Herzog / Hilke Rebenstorf / Bernhard Weßels (Hrsg.), Parlament und Gesellschaft. Eine Funktionsanalyse der repräsentativen Demokratie, Opladen 1993; Hans-Ulrich Derlien / Stefan Lock, Eine neue politische Elite? Rekrutierung und Karrieren der Abgeordneten in den fünf neuen Landtagen, in: ZParl, 25. Jg. (1994), H. 1, S. 61 – 94; Wilhelm P. Bürklin / Hilke Rebenstorf (Hrsg.), Eliten in Deutschland. Rekrutierung und Integration, Leverkusen 1997; Viktoria Kaina, Deutschlands Eliten – Kontinuität und Wandel, in: APuZ, 54. Jg. (2004), H. 10, S. 8 – 16; Andrea Römmele, Elitenrekrutierung und die Qualität politischer Führung, in: ZfP, 51. Jg. (2004), H. 3, S. 259 – 276; Michael Hartmann, Eliten in Deutschland, in: APuZ, 54. Jg. (2004), H. 10, S. 17 – 24; ders., Eliten und Macht in Europa. Ein internationaler Vergleich, Frankfurt am Main 2007.
14 Zu den genannten Einzelaspekten der Abgeordnetenforschung gibt es insbesondere seit den 1980er Jahren zahlreiche Studien und Befunde, die hier wegen der unumgänglichen Umfangbeschränkung nicht detailliert dokumentiert werden können.
15 Auch hier könnte eine Fülle von Beiträgen genannt werden; insbesondere sei auf die umfangreichen Forschungen von Werner J. Patzelt verwiesen.
16 Siehe Oscar W. Gabriel / Eric Kerrouche / Suzanne S. Schüttemeyer (Hrsg.), Political Representation in France and Germany. Attitudes and Activities of Citizens and MPs, Cham 2018.
17 Vgl. Danny Schindler / Sven T. Siefken, Wahlkreisarbeit der Abgeordneten des Deutschen Bundestages – ein Beitrag zur Parlamentarischen Kontrolle?, in: Birgit Eberbach-Born / Sabine Kropp / Andrej Stuchlik / Wolfgang Zeh (Hrsg.), Parlamentarische Kontrolle und Europäische Union, Baden-Baden 2013, S. 203 – 225.
18 Dietrich Herzog, Politische Karrieren. Selektion und Professionalisierung politischer Führungsgruppen, Wiesbaden 1975.
19 Jens Borchert / Klaus Stolz, Die Bekämpfung der Unsicherheit. Politikerkarrieren und Karrierepolitik in der Bundesrepublik Deutschland, in: PVS, 44. Jg. (2003), H. 2, S. 148 – 173; vgl. auch Heinrich Best / Christopher Hausmann / Karl Schmitt, Challenges, Failures, and Final Success: The Winding Path of German Parliamentary Leadership Groups towards a Structurally Integrated Elite 1848-1999, in: Heinrich Best / Maurizio Cotta (Hrsg.), Parliamentary Representatives in Europe 1848-2000. Legislative Recruitment and Career in Eleven European Countries, New York 2000, S. 138 – 195; Michael Edinger / Stefan Jahr, Political Careers in Europe. Career Patterns in Multi-Level Systems, Baden-Baden 2015.
20 Vgl. Hermann Schmitt / Andreas M. Wüst, Direktkandidaten bei der Bundestagswahl 2002: Politische Agenda und Links-Rechts-Einstufung im Vergleich zu den Wählern, in: Frank Brettschneider (Hrsg.), Die Bundestagswahl 2002. Analysen der Wahlergebnisse und des Wahlkampfes, Wiesbaden 2004, S. 303 – 325; Andreas M. Wüst / Hermann Schmitt / Thomas Gschwend / Thomas Zittel, Candidates in the 2005 Bundestag Election: Mode of Candidacy, Campaigning and Issues, in: German Politics, 15. Jg. (2006), H. 4, S. 420 – 438; für die Bundestagswahlen 2009, 2013 und 2017 wurde die Kandidatenstudie im Rahmen der German Longitudinal Election Study (GLES) fortgeführt, vgl. Heiko Giebler / Thomas Gschwend / Sara Schlote / Hermann Schmitt / Maike Vollmar / Bernhard Weßels / Andreas M. Wüst / Thomas Zittel, GLES Kandidatenstudie 2009: Motive, Nominierung, Wahlkampf, Repräsentation und Demokratie aus der Sicht der Kandidatinnen und Kandidaten der Bundestagsparteien zur Bundestagswahl 2009, Berlin 2012 sowie die 2014 und 2018 vom WZB veröffentlichten Nachfolgestudien.
21 Philip Manow / Peter Flemming, Der Kandidat/die Kandidatin – das gar nicht mehr so unbekannte Wesen, in: ZParl, 43. Jg. (2012), H. 4, S. 766 – 784.
22 Siehe Benjamin Höhne / Melanie Kintz, Soziale Herkunftslinien von Abgeordneten im Wandel, in: Elmar Wiesendahl (Hrsg.), Parteien und soziale Ungleichheit, Wiesbaden 2017, S. 259 – 285; Philip Manow, Wahlkreis- oder Listenabgeordneter, Typus oder Episode? Eine Sequenzanalyse der Wege in den Bundestag, in: PVS, 53. Jg. (2012), H. 1, S. 53 – 78.
23 Werner J. Patzelt, Parlamentarische Rekrutierung und Sozialisation. Normative Erwägungen, empirische Befunde und praktische Empfehlungen, in: ZfP, 46. Jg. (1999), H. 3, S. 241 – 282.
24 Bodo Zeuner, a.a.O. (Fn. 2).
25 Heino Kaack, a.a.O. (Fn. 3).
26 Vgl. Peter Haungs, Mitgliederbefragung zur Landtagskandidatenaufstellung. Das Experiment des CDU-Bezirksverbandes Rheinhessen-Pfalz, in: ZParl, 1. Jg. (1970), H. 4, S. 403 – 417; Rüdiger Andel, Das Vorwahlverfahren zur Landtags-Kandidatenaufstellung der CDU im rheinland-pfälzischen Wahlkreis III (Regierungsbezirk Trier), in: ZParl, 2. Jg. (1971), H. 4, S. 444 – 448.
27 Vgl. Wolfgang Horn / Herbert Kühr, Kandidaten im Wahlkampf. Kandidatenauslese, Wahlkampf und lokale Presse 1975 in Essen, Meisenheim am Glan 1978.
28 Vgl. Wolfgang Hackel, Die Auswahl des politischen Nachwuchses in der Bundesrepublik Deutschland. Die junge Union als Sprungbrett für politische Karrieren in der CDU, Stuttgart 1978.
29 Vgl. Karlheinz Kaufmann / Helmut Kohl / Peter Molt (Hrsg.), Kandidaturen zum Bundestag. Die Auswahl der Bundestags-Kandidaten 1957 in zwei Bundesländern, Köln 1961; Alf Mintzel, Kandidatenauslese für den Bundestag über die Landesliste: Eine Fallstudie über die Aufstellung der CSU-Landeslisten zu den Bundestagswahlen 1957 und 1961, in: ZParl, 11. Jg. (1980), H. 1, S. 18 – 38; Günter Pumm, Kandidatenauswahl und innerparteiliche Demokratie in der Hamburger SPD. Eine empirische Untersuchung der Kandidatennominierungen für die Bundestagswahl 1969, die Bürgerschaftswahl 1970, den Senat und die Deputationen, Frankfurt am Main 1977; Peter Staisch, Die Kandidatenaufstellung zur Wahl des VI. Deutschen Bundestages bei der CDU Württemberg-Hohenzollern 1969, Tübingen 1974; Stephen Francis Szabo, Party Recruitment in the Federal Republic of Germany. Candidate Selection in a West German State, PhD Thesis, Georgetown University 1978; Heinz J. Varain, Kandidaten und Abgeordnete in Schleswig-Holstein 1947-1958, in: PVS, 2. Jg. (1961), H. 4, S. 363 – 411.
30 Bernhard Weßels, Germany, in: Pippa Norris (Hrsg.), Passages to Power. Legislative Recruitment in Advanced Democracies, Cambridge 1997, S. 76 – 97; Geoffrey K. Roberts, The German Federal Republic: The Two Lane Route to Bonn, in: Michael Gallagher / Michael Marsh (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 10), S. 94 – 118.
31 Bernhard Weßels lag außerdem, wie er uns mitteilte, eine unveröffentlichte Doktorarbeit vor: Stephen Robert Porter, Political Representation in Germany: The Effects of the Candidate Selection Committees, PhD Thesis University of Rochester 1995.
32 Pippa Norris (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 30); Michael Gallagher / Michael Marsh (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 10).
33 Einen Ansatz dazu legten Gideon Rahat und Reuven Y. Hazan zu Israel vor, wo – bei sonst gleich bleibenden systemstrukturellen Gegebenheiten – sich eine Änderung des Wahlsystems nachweisbar auf die personelle Zusammensetzung des Parlaments auswirkte, Gideon Rahat / Reuven Y. Hazan, Candidate Selection Methods: An Analytical Framework, in: Party Politics, 7. Jg. (2001), H. 3, S. 297 – 322.
34 Pippa Norris / Joni Lovenduski, Political Recruitment. Gender, Race, and Class in the British Parliament, Cambridge 1995.
35 Vgl. Suzanne S. Schüttemeyer / Roland Sturm, Der Kandidat – das (fast) unbekannte Wesen. Befunde und Überlegungen zur Aufstellung der Bewerber zum Deutschen Bundestag, in: ZParl, 36. Jg. (2005), H. 3, S. 539 – 553, S. 551 f.
36 Vgl. Benjamin Höhne, a.a.O. (Fn. 7), S. 102 – 105; ders., Reform von Kandidatenaufstellungen, in: Oskar Niedermayer / Benjamin Höhne / Uwe Jun (Hrsg.), Abkehr von den Parteien? Parteiendemokratie und Bürgerprotest, Wiesbaden 2013, S. 177 – 203; ders., Selektieren Medien Parlamentskandidaten? Medieneinfluss und Medienkompetenz bei innerparteilichen Nominierungen, in: Franziska Oehmer (Hrsg.), Politische Interessenvermittlung und Medien. Funktionen, Formen und Folgen medialer Kommunikation von Parteien, Verbänden und sozialen Bewegungen, Baden-Baden 2014, S. 94 – 114.
37 Vgl. Reuven Y. Hazan / Gideon Rahat, Democracy within Parties. Candidate Selection Methods and their Political Consequences, Oxford 2010; Gideon Rahat, Which Candidate Selection Method is the Most Democratic?, in: Government and Opposition, 44. Jg. (2009), H. 1, S. 68 – 90; Gideon Rahat / Reuven Y. Hazan, a.a.O. (Fn. 33).
38 Marion Reiser, Wer entscheidet unter welchen Bedingungen über die Nominierung von Kandidaten? Die innerparteilichen Selektionsprozesse zur Aufstellung in den Wahlkreisen, in: Oskar Niedermayer (Hrsg.), Die Parteien nach der Bundestagswahl 2009, Wiesbaden 2011, S. 237 – 259; dies., Ausmaß und Formen des innerparteilichen Wettbewerbs auf der Wahlkreisebene: Nominierung der Direktkandidaten für die Bundestagswahl 2009, in: Thorsten Faas / Kai Arzheimer / Sigrid Roßteutscher / Bernhard Weßels (Hrsg.), Koalitionen, Kandidaten, Kommunikation. Analysen zur Bundestagswahl 2009, Wiesbaden 2013, S. 129 – 147.
39 Vgl. Benjamin Höhne, Wie stellen Parteien ihre Parlamentsbewerber auf?, in: Carsten Koschmieder (Hrsg.), Parteien, Parteiensysteme und politische Orientierungen. Aktuelle Beiträge aus der Parteienforschung, Wiesbaden 2017, S. 227 – 253, S. 245.
40 Vgl. Klaus Detterbeck, Candidate Selection in Germany, in: American Behavioral Scientist, 60. Jg. (2016), H. 7, S. 837 – 852, S. 848.
41 Ebenda.
42 Christian Steg, Die Kandidatenaufstellung zur Bundestagswahl. Analyse der Nominierungen von CDU und SPD in Baden-Württemberg zur Bundestagswahl 2009, Baden-Baden 2016.
43 Klaus Detterbeck, a.a.O. (Fn. 40), S. 844.
44 Zur Begriffsbestimmung vgl. den Beitrag von Daniel Hellmann in diesem Heft der ZParl.
45 Benjamin Höhne, a.a.O. (Fn. 39), S. 244.
46 Michael Edinger, Politik als Beruf in der repräsentativen Demokratie. Deutschlands Abgeordnete als Kern einer politischen Klasse?, in: Christoph Meißelbach, / Jakob Lempp / Stephan Dreischer (Hrsg.), Politikwissenschaft als Beruf. Perspektiven aus Wissenschaft und Gesellschaft, Wiesbaden 2018, S. 75 – 88.
47 Vgl. Tamaki Ohmura / Stefanie Bailer / Peter Mei?ner / Peter Selb, Party Animals, Career Changers and other Pathways into Parliament, in: West European Politics, 41. Jg. (2017), H. 1, S. 169 – 195.
48 Vgl. ebenda, S. 178.
49 Vgl. ebenda, S. 187.
50 Benjamin Höhne, Politik ist (k)ein Männergeschäft? Eine genderfokussierte Analyse der parteilichen Kandidierenden-Auswahl zu Bundestagswahlen, böll.brief Demokratie & Gesellschaft, Berlin 2019, S. 9.
51 Vgl. ebenda, S. 273. Siehe die nach jeder Bundestagswahl erscheinenden Analysen der Berufsstruktur des Bundestages in der ZParl, zuletzt Melanie Kintz / Malte Cordes, a.a.O. (Fn. 3).
52 Vgl. Lars Bille, Democratizing a Democratic Procedure. Myth or Reality? Candidate Selection in Western European Parties, 1960-1990, in: Party Politics, 7. Jg. (2001), H. 3, S. 363 – 380; Reuven Y. Hazan / Gideon Rahat, Democracy within Parties, a.a.O. (Fn. 37), S. 91 ff.; Ofer Kenig / Scott Pruysers, The Challenges of Inclusive Intra-Party Selection Methods, in: Guillermo Cordero / Xavier Coller (Hrsg.), Democratizing Candidate Selection. New Methods, old Receipts?, Cham 2018, S. 25 – 48.
53 Auf einer Mitgliederversammlung sind alle Parteimitglieder stimmberechtigt, wenn sie zum Versammlungszeitpunkt für die anstehende Bundestagwahl wahlberechtigt sind. Delegierte werden vor der Kandidatenaufstellung aus dem Kreise der Parteimitglieder vor Ort, das heißt auf unterster Ebene der Partei, gewählt. Satzungsbestimmungen zur Anwendung eines Verfahrens bilden auf der Wahlkreisebene eher die Ausnahme.
54 Suzanne S. Schüttemeyer / Roland Sturm, a.a.O. (Fn. 35), S. 541 f.
55 Marion Reiser, Wer entscheidet, a.a.O. (Fn. 38), S. 245.
56 Außerdem in gezielt ausgewählten 23 Wahlkreisen und sechs Landesversammlungen.
57 Nähere Einzelheiten zur Datenerhebung finden sich in den Methodenberichten zum Projekt unter https://www.iparl.de/de/projekt-kandidatenaufstellung.html.
58 Zur detaillierten Satzungsanalyse vgl. den Beitrag von Benjamin Höhne und Daniel Hellmann in diesem Heft der ZParl.
59 Vgl. Suzanne S. Schüttemeyer / Roland Sturm, a.a.O. (Fn. 35), S. 542.
60 Für Einzelheiten dieser Bestandsaufnahme des IParl siehe Benjamin Höhne, a.a.O. (Fn. 39), S. 235 ff. Marion Reiser verneint diesen Trend, allerdings auf beschränkter Datengrundlage: Für die Kandidatenaufstellungen zur Bundestagswahl 2009 bezieht sie in die Kalkulation zur Durchführung von Mitglieder- bzw. Delegiertenversammlungen Bündnis 90/Die Grünen und FDP nicht mit ein (die auf Wahlkreisebene nahezu immer Mitgliederversammlungen durchführen) und betrachtet bei der Linken nur die Wahlkreisnominierungen im Osten Deutschlands, Marion Reiser, Wer entscheidet, a.a.O. (Fn. 38), S. 245.
61 Vgl. den Beitrag von Daniel Hellmann und Benjamin Höhne in diesem Heft der ZParl.
62 Zum Verhältnis von Mitgliedereinbindung und Mitgliederbeteiligung vergleiche den Abschnitt „Inclusiveness versus Turnout“ in: Reuven Y. Hazan / Gideon Rahat, Democracy within Parties, a.a.O. (Fn. 37), S. 90 f.
63 Die Mitgliederzahlen von 2016 für die prozentuale Berechnung sind entnommen aus: Oskar Niedermayer, Parteimitgliedschaften im Jahre 2016, in: ZParl, 49. Jg. (2017), H. 2, S. 370 – 396, S. 375.
64 Ebenda.
65 Siehe Anastasia Pyschny / Daniel Hellmann, Wann ist „sicher“ sicher? Kriterien zur Operationalisierung sicherer Wahlkreise im Vergleich, in: ZParl, 48. Jg. (2017), H. 2, S. 350 – 369. Ausnahmen bildeten bei der Bundestagswahl 2017 die Wahlkreise 84 (Berlin-Treptow – Köpenick) und 86 (Berlin-Lichtenberg) für Die Linke sowie der Wahlkreis 83 (Berlin-Friedrichshain – Kreuzberg – Prenzlauer Berg Ost) für Bündnis 90/Die Grünen, die im Vorfeld ebenfalls als „sicher“ eingestuft werden konnten und von den Parteien schließlich direkt gewonnen wurden.
66 Vgl. Suzanne S. Schüttemeyer / Roland Sturm, a.a.O. (Fn. 35), S. 548.
67 Die Mitgliederzahlen wurden dem IParl von den Parteien bereitgestellt. Demnach kamen die Grünen in Cloppenburg auf 46 und in Vechta auf 26 Mitglieder, Die Linke in Cloppenburg auf 21 und in Vechta auf 18 Mitglieder (Stand 31. Dezember 2016).
68 Für die AfD kommt Marion Reiser mit einem Inklusionswert von 20,2 Prozent der Parteimitglieder auf Landeslistenaufstellungen für die Bundestagswahl 2017 zu einem nahezu identischen Ergebnis. Vgl. Marion Reiser, Contagion Effects by the AfD: Candidate Selection in Germany, in: Xavier Coller / Guillermo Cordero / Antonio M Jaime Castillo (Hrsg.), The Selection of Politicians in Times of Crisis, New York 2018, S. 81 – 97, S. 87.
69 Dies gilt auch für die Operationalisierung innerparteilicher Demokratie (IPD) mithilfe von Inklusionsstufen wie z.B. „Auswahl durch Parteimitglieder“ oder „Auswahl durch Parteidelegierte“, wie sie in einschlägigen Untersuchungen zur Anwendung kommen: vgl. jüngst Benjamin von dem Berge / Thomas Poguntke, Varieties of Intra-Party Democracy: Conceptualization and Index Construction, in: Susan E. Scarrow / Paul D. Webb / Thomas Poguntke (Hrsg.), Organizing Political Parties. Representation, Participation and Power. Oxford 2017, S. 136 – 157, S. 147 sowie Gideon Rahat / Assaf Shapira, An Intra-Party Democracy Index: Theory, Design and a Demonstration, in: Parliamentary Affairs, 70. Jg. (2017), H. 1, S. 84 – 110. Auch hierbei ist zu bedenken, dass mitgliederstärkere Parteien für die Durchführung von Mitgliederversammlungen mehr Ressourcen einsetzen müssen als mitgliederschwächere Parteien und deshalb nicht auszuschließen ist, dass erstere Delegierten-versammlungen vor allem aus organisatorischen und weniger aus strategischen Gründen durchführen – ein Problem, das mitgliederschwächere Parteien weniger stark tangiert und diese in Folge unter leichteren Umständen einen höheren IPD-Wert erzielen können.
70 Zum 31. Dezember 2016 verzeichnete die CDU 431.920 und die SPD 432.706 Mitglieder. Die FDP wies mit 53.896 ähnliche Mitgliederzahlen auf wie Bündnis 90/Die Grünen (61.596 Mitglieder) und Die Linke (58.910 Mitglieder); die CSU mit 142.412 und die AfD mit 25.015 Mitgliedern werden daher nicht berücksichtigt. Vgl. Oskar Niedermayer, a.a.O. (Fn. 63).
71 Vgl. den Beitrag von Daniel Hellmann und Benjamin Höhne in diesem Heft der ZParl.
72 Ebenda.
73 Zur Personalsuche im Zuge des FDP-Modernisierungskurses vgl. Benjamin Höhne / Uwe Jun, Die Wiederauferstehung der FDP, in: Karl-Rudolf Korte / Jan Schoofs (Hrsg.), Die Bundestagswahl 2017, Wiesbaden 2019, S. 225 – 245; S. 237 f. sowie Benjamin Höhne / Daniel Hellmann, Die Freien Demokraten. Comeback der FDP mit neuer Mannschaft, Mit-Mach-Organisation und Mut-Mach-Liberalismus, Konrad-Adenauer-Stiftung, Sankt Augustin / Berlin 2017, S. 34 ff.
74 Bodo Zeuner, Wahlen ohne Auswahl – Die Kandidatenaufstellung zum Bundestag, in: Winfried Steffani (Hrsg.), Parlamentarismus ohne Transparenz, Wiesbaden 1971, S. 165 – 190, S. 171.
75 Rainer-Olaf Schultze, Partizipation, in: Dieter Nohlen / ders. (Hrsg.), Politische Theorien. Lexikon der Politik, Bd. 1, München 1995, S. 398.
76 Die Mitgliederzahlen von 2001 und 2016 für die prozentuale Berechnung sind entnommen aus: Oskar Niedermayer, a.a.O. (Fn. 63).
77 Vgl. Suzanne S. Schüttemeyer, Wer wählt wen wie aus? Pfade in das unerschlossene Terrain der Kandidatenaufstellung, in: Gesellschaft. Wirtschaft. Politik, 51. Jg. (2002), H. 2, S. 145 – 159, S. 150.
78 Vgl. für die Aufstellung der Direktkandidaten zur Bundestagswahl 2002: Satzung der Christlich Sozialen Union in der Fassung vom 23. November 2002 § 31 Abs. 1 und zur Bundestagswahl 2017: Satzung der Christlich Sozialen Union in der Fassung vom 20. November 2015 § 33 Abs. 1.
79 Vgl. Oskar Niedermayer, a.a.O. (Fn. 63).
80 Vgl. Elmar Wiesendahl / Benjamin Höhne / Malte Cordes, Mitgliederparteien – Niedergang ohne Ende?, in: ZParl, 49. Jg. (2018), H. 2, S. 304 – 324, S. 319 f.
81 Die Mitgliederzahlen von 2001 und 2016, also vor der jeweiligen Bundestagswahl, sind entnommen aus: Oskar Niedermayer, a.a.O. (Fn. 63). Der prozentuale Partizipationsrückgang der Elektoren ist berechnet auf Basis der (geschätzten) Teilnehmerzahlen an den Wahlkreisnominierungen (vgl. Tabelle 3).
_________________________________
Dieser Aufsatz wurde erstmals veröffentlicht in Zeitschrift für Parlamentsfragen (ZParl), Heft 1/2020, Seite 189-211. Die Redaktion dankt dem Nomos Verlag für die freundliche Genehmigung zur Zweitveröffentlichung.
ZParl-Schwerpunkt:
Die Kandidatenaufstellung zur Bundestagswahl 2017
Daniel Hellmann / Benjamin Höhne
Die formale Dimension der Kandidatenaufstellungen: Satzungen im Parteien- und Zeitvergleich
Zeitschrift für Parlamentsfragen (Zparl) Heft 1/2020: 3-25
Danny Schindler
In den „geheimen Gärten“ der Vorauswahl. Variationen der Listenaufstellung von CDU und SPD zum 19. Deutschen Bundestag
Zeitschrift für Parlamentsfragen (Zparl) Heft 1/2020: 25-48
Daniel Hellmann
Der mühselige Weg zum Mandat – aber welcher? Empirische Untersuchungen zu Inhalt und Bedeutung der Ochsentour
Zeitschrift für Parlamentsfragen (Zparl) Heft 1/2020: 49-67
Malte Cordes / Daniel Hellmann
Wer ist der ideale Kandidat? Auswahlkriterien bei der Kandidatenaufstellung zum Deutschen Bundestag
Zeitschrift für Parlamentsfragen (Zparl) Heft 1/2020: 68-83
Oliver Kannenberg
„Wir gucken zuerst auf uns“ – nur wie lange noch? Parteienwettbewerb bei der Kandidatenaufstellung zur Bundestagswahl 2017
Zeitschrift für Parlamentsfragen (Zparl) Heft 1/2020: 84-104
Benjamin Höhne
Mehr Frauen im Bundestag? Deskriptive Repräsentation und die innerparteiliche Herausbildung des Gender Gaps
Zeitschrift für Parlamentsfragen (Zparl) Heft 1/2020:105-125
Zum Überblick
über das gesamte Heft 1/2020
Rezension
{BID=41107} Die Fraktionen zählen zu den wichtigsten Handlungseinheiten des Bundestages. Folglich kommt dem Amt des Fraktionsvorsitzenden im Parlamentsbetrieb große Bedeutung zu, dem sich Danny Schindler widmet. Die wesentliche Grundlage seiner Untersuchung bilden Leitfadeninterviews. Sie vermitteln konkrete „Einblicke in den Maschinenraum vom Fraktionsleben“, wie Rezensent Arno Mohr schreibt. Schindler gehe nicht nur auf die zahlreichen Steuerungsmöglichkeiten von Vorsitzenden ein, sondern mache auch Ausführungen, wie diese im Willensbildungsprozess der Fraktionen eingesetzt werden können.
weiterlesen
Werkstattbericht
Die Kandidatenaufstellung zur Bundestagswahl 2017. Ein Blick in die Forschungspraxis des Projekts #BuKa2017
Im Vorwege der Bundestagswahl 2017 hat das Institut für Parlamentarismusforschung (IParl) die Kandidatenaufstellung zum Deutschen Bundestag systematisch untersucht. Ein Jahr lang wurde vor und hinter die Kulissen zahlreicher Nominierungsveranstaltungen aller aktuell im Bundestag vertretenen Parteien geblickt. Wie dieses hinsichtlich seines Umfangs beispiellose Forschungsprojekt #BuKa2017 ablief (von der Wahl der Untersuchungsgegenstände bis zur Frage, wie mit den Daten umzugehen ist), zeigt der hier gewährte Einblick in die Forschungspraxis.
weiterlesen
Rezension
{BID=40814} Zu den Folgen der europäischen Währungs- und Staatsschuldenkrise zählt, dass sich neue Parteien gebildet haben. In diesem Band wird gefragt, ob deren Abgrenzung zu den etablierten Parteien sich auch in den Verfahren spiegelt, mit denen sie ihre Parlamentskandidaten auswählen – womit die innerparteiliche Demokratie in den Fokus rückt. Es zeigt sich, dass etwa Podemos, MoVimento 5 Stelle oder NEOS zumeist auf im Prinzip erprobte Verfahren zurückgreifen, bei denen die Parteiführungen Einfluss ausüben. In weiteren Beiträgen werden die veränderten Rahmenbedingungen für die Aufstellung von Kandidaten diskutiert.
weiterlesen
Weitere Lektüre
Parlamentarismus
Aus Politik und und Zeitgeschichte
APuZ 38/2020
Peter Dausend, Horand Knaup
„Alleiner kannst du gar nicht sein“. Unsere Volksvertreter zwischen Macht, Sucht und Angst
München, dtv 2020
zum Thema
Demokratie gestalten – zum Verhältnis von Repräsentation und Partizipation
zum Thema
Bundestagswahl 2017