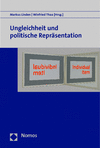Peter Graf Kielmansegg: Repräsentation und Partizipation. Überlegungen zur Zukunft der repräsentativen Demokratie
Sozialwissenschaften sind Krisenwissenschaften, schreibt Peter Graf Kielmansegg. Sie diagnostizieren gesellschaftliche Krisen und entzünden an ihnen ihren sozialwissenschaftlichen Diskurs. Auch in der Debatte um den Gesundheitszustand der repräsentativen Demokratie wird Krisenstimmung verbreitet und sogar ihr Ende vorausgesagt. Wie steht es nun um die repräsentative Demokratie? Und was sagen die Krisensymptome über mögliche Entwicklungen aus? Ist die direkte Demokratie eine Lösung? Graf Kielmansegg argumentiert demokratietheoretisch mit der Komplementarität von Repräsentation und Partizipation.
Sozialwissenschaften sind Krisenwissenschaften, schreibt Peter Graf Kielmansegg. Sie diagnostizieren gesellschaftliche Krisen und entzünden an ihnen ihren sozialwissenschaftlichen Diskurs. Auch in der Debatte um den Gesundheitszustand der repräsentativen Demokratie wird Krisenstimmung verbreitet und sogar ihr Ende vorausgesagt. Wie steht es nun um die repräsentative Demokratie? Und was sagen die Krisensymptome über mögliche Entwicklungen aus? Ist die direkte Demokratie eine Lösung?
Graf Kielmansegg argumentiert demokratietheoretisch mit der Komplementarität von Repräsentation und Partizipation. Dazu fächert er zuerst im historischen Vergleich verschiedene Sichtweisen auf die repräsentative Demokratie auf (zum Beispiel Madison, Sieyès, Pain). Darauf aufbauend folgert er, dass heute Repräsentation zuerst durch die Übertragung von Macht in eine Ämterordnung charakterisiert sei. Innerhalb dieser Ordnung sei sie rechtlich eingehegt, zeitlich befristet, gemeinwohlgebunden und die Amtsträger rechenschaftspflichtig gemacht. Konkret bedeute dies auch, dass Amtsträger nicht nur ihren Wählern, sondern auch dem Allgemeinwohl verpflichtet sind. Entgegen dem Vorwurf der Machtlosigkeit beschränkten sich deren Einflussmöglichkeiten nicht nur auf die Wahl, sondern fänden in vielerlei Art ihre Partizipationsmöglichkeit im öffentlichen Dialog (zum Beispiel durch Interessengruppen). Für Graf Kielmansegg bildet ein verstetigter politischer und damit institutionalisierter Prozess erst die Möglichkeit einer „sinnvollen Partizipation“ (13). Dass Politik nicht alle Erwartungen erfüllen könne, führe zu einer notwendigen Enttäuschung und bilde damit einen Spannungsfaktor im Verhältnis zwischen Repräsentation und Partizipation. Dazu trage auch die Tatsache bei, dass Politiker sowohl den Partikularinteressen ihrer Wähler als auch dem Allgemeinwohl verpflichtet seien. Hinzu komme schließlich das Infragestellen der Entscheidungskompetenz des Gewählten durch die Wählenden.
Die Krise des Vertrauens in die repräsentative Demokratie, vielfach durch Umfragen belegt, und das sich ändernde Partizipationsverhalten gelten für Graf Kielmansegg als markante Krisensymptome. Das Vertrauen der Wähler in Akteure, die aktiv im Politikprozess beteiligt sind, sinkt in den vergangenen Jahren deutlich und ist in allen „etablierten Demokratien“ (18) erkennbar. Aber auch das für einen funktionierenden Dialog notwendige Vertrauen der Gewählten in die Wähler sinkt und führt zu einer gegenseitigen Entfremdung. Die Partizipation der Wähler am politischen Prozess, gemessen an der Wahlbeteiligung, sinkt, besonders auf Landes- und der regionalen Ebene. Zusammen mit der Erkenntnis, dass die Anzahl der Nicht-Wähler in den sozial schwachen Schichten besonders hoch ist, führt dies zu einer beunruhigenden Situation. Die sinkende Bereitschaft, sich permanent politisch zu engagieren, lässt sich auch an der sinkenden Mitgliederzahl der etablierten Parteien nachvollziehen. Das Beteiligungsverhalten der Bürger am Politikprozess ist /index.php?option=com_content&view=article&id=41317orientierter, zeitlich befristet und damit projektartiger geworden. Allgemein wird die Politik für die Enttäuschung der Wähler und damit für die Erosion der Beteiligung verantwortlich gemacht. Der Autor führt jedoch eine Reihe von Gründen auf, die eine solche Schuldzuschreibung kritisch hinterfragen. Dazu gehören eine steigende Komplexität der politischen Lage und Probleme globalen Zuschnitts, die nicht mehr allein von einer Regierung gelöst werden können, wie zum Beispiel der Klimawandel und die Finanzkrise. Weiterhin spielen gesellschaftliche Entwicklungen eine Rolle, wie zum Beispiel die Auflösung sozialer Strukturen, etwa der Familie, und ein Ausfasern des normativen Konsenses zu Fragen wie der Sterbehilfe, der gleichgeschlechtlichen Ehe oder der Gentherapie. Beihilfe zu dieser Entwicklung leisten nach Ansicht des Autors Medienstrategien der Skandalisierung und das mangelnde Vermögen oder Willen der Parteien, sich in ihren Programmen voneinander abzugrenzen.
In diesem Klima der Unsicherheit eines etablierten Systems wird nun die Frage nach mehr Partizipation gestellt, um ein gefühltes demokratisches Defizit zu heilen. Bedeutet, so Graf Kielmansegg, mehr direkte Partizipation gleich mehr Demokratie? Der Autor führt verschiedene Argumente ins Feld, um die problematischen Aspekte der direkten Demokratie zu illustrieren. Dazu gehört die Tatsache, dass sich nicht jeder Beteiligte einer Volksabstimmung hinlänglich informieren könne, die Entscheidung bei Spezialisten also besser aufgehoben sei. Auch bestehe das Problem, dass aktive Minderheiten in diesen Entscheidungen größere passive Mehrheiten ihren Willen auferlegen könnten. Es bleibe dabei, dass die repräsentative Wahl durch die Anzahl der an ihr Beteiligten mehr legitimatorisches Potenzial enthalte als durch wesentlich geringere Beteiligung gekennzeichnete Volksabstimmungen bieten könnten. Normativ argumentiert Graf Kielmansegg, wenn er befürchtet, dass das konstitutierende Ämterprinzip, das eine demokratische Legitimierung und Kontrolle ermögliche, durch direktdemokratische Instrumente aufgeweicht werde. Plausibel erscheint das Risiko, dass direktdemokratische Instrumente von der Opposition zur Obstruktion genutzt werden könnten oder als Möglichkeit, eigene Ziel gegen die von einer parlamentarischen Mehrheit getragene Regierung durchzusetzen, und daraus eine Verwischung von Zuschreibungs- und Verantwortungsprinzip erfolgt. Für besonders problematisch hält der Autor in diesem Kontext den Trend, Entscheidungen aus der Regierung durch einen Mitgliederentscheid in die Parteien zu tragen – eine Praxis, die die Balance zwischen Repräsentation und Partizipation nachhaltig aus dem Lot zu bringen in der Lage ist.
Mehr Bürgerbeteiligung an der repräsentativ verfassten Demokratie, schlussfolgert Graf Kielmansegg, sei wünschenswert. Wie diese zu institutionalisieren sei, bleibe jedoch kritisch zu prüfen und mit Realitätssinn zu bewerten. Die Zukunft ist nicht nur, aber zunächst erst einmal durch die Gegenwart der repräsentativen Demokratie bestimmt. Der Autor liefert damit neben einer klaren Darstellung aktueller Entwicklungen eine überzeugend pragmatische Einordnung der Diskussion über die repräsentative Demokratie.
Aus der Annotierten Bibliografie
zum Thema
Demokratie gestalten – zum Verhältnis von Repräsentation und Partizipation