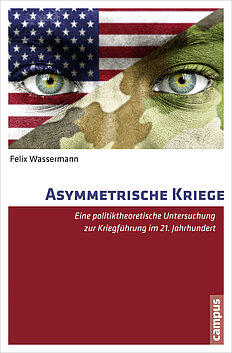Jochen Hippler: Krieg im 21. Jahrhundert. Militärische Gewalt, Aufstandsbekämpfung und humanitäre Intervention
Jochen Hippler führt durch die Geschichte des Krieges und macht dessen wandelbaren Charakter deutlich. Im 21. Jahrhundert sei die Tendenz zu einer Verschmelzung von zwischenstaatlichen und Bürgerkriegen und einer Fusion konventioneller sowie unkonventioneller Kriege erkennbar, die sich immer schneller wandelten. Aus gewaltlosen Aufständen entstünden leicht gewaltsame Bürgerkriege und regionale Konflikte. Den Schwerpunkt des Buches sieht Rezensent Michael Rohschürmann in der Analyse und Bewertung der historischen Erkenntnisse sowie deren Vergleich mit aktuellen Entwicklungen und den politischen Reaktionen darauf.
Der Charakter von Krieg hat sich in den vergangenen Jahrhunderten dramatisch geändert. Mit der fortschreitenden Mechanisierung, die den einzelnen Krieger zu einem machtlosen Rad im Getriebe eines „bürokratischen Gewaltapparates“ (7) gemacht hat, ist aus Heraklits Vater aller Dinge im Atomzeitalter die Angst vor der totalen Auslöschung geworden. Jochen Hippler führt die Leser*innen durch die Geschichte des Krieges und macht vor allem dessen wandelbare Beschaffenheit deutlich.
Dabei widmet Hippler sich auch den grundsätzlichen Fragen wie der, ob Krieg Teil der conditio humama und daher unausweichlich ist oder ein gesellschaftliches Konstrukt darstellt. Bereits aus Gründen der trennscharfen Definition ist es wenig zielführend, jede Form von Gruppengewalt als Krieg zu bezeichnen. Entsprechend spricht er sich dafür aus, dass „Krieg eine Gewaltform darstellt, die einen politischen Charakter trägt und ein gewisses Maß an Planung und Organisation erfordert.“ (17)
Entsprechend geht die Entstehung von Kriegen einher mit der Sesshaftwerdung und der Entwicklung von Staaten. Frühe Spuren von Krieg finden sich erst im Mesolithikum bei sesshaften Fischern im oberen Niltal. „Kriege treten zum ersten Mal auf, als Wildbeuter sesshaft und verstärkt von lokal konzentrierten Ressourcen abhängig wurden.“ (18)
„Alles deutet darauf hin, dass verschiedene, schon lange bestehende Gewaltformen sich schrittweise zum Krieg verdichteten, als durch Sesshaftigkeit, Landwirtschaft und Vorratshaltung, höre Bevölkerungsschichten und die Herausbildung politischer Strukturen entsprechende Anreize und Mittel zur Kriegführung geschaffen wurden.“ (21) Die Art der Kriegsführung hing lange mit den waffentechnischen Entwicklungen direkt zusammen. So waren größere stehende Heere nur von wirtschaftlich potenten Imperien zu unterhalten, was nach dem Ende des Römischen Reiches in Europa den Aufstieg des Adels als dislozierten Kriegsunternehmern mit hoher Kampfkraft und schneller Beweglichkeit beförderte. Lange waren die Kriegsziele begrenzt, es drehte sich zumeist um Einflusszonen und direkte Konflikte zwischen Adligen. Mit den Napoleonischen Kriegen, bei denen es auch um weltanschauliche Fragen ging, wurden die Kriege zunehmend totalitärer und die Wehrpflichtarmee, als Grundlage des französischen Erfolges, macht auch die Bevölkerung direkt zu einer Ressource des Krieges. „Als die Bevölkerung zur Ressource und zum Akteur des Krieges geworden war, wurde sie selbst auch zu seinem Ziel, und die Moral der Bevölkerung zu brechen, wurde zu einer üblichen Strategie“ (108).
Parallel zu diesen europäischen Entwicklungen untersucht Hippler die kolonialen Kriege, deren Erfolg, im Gegensatz zu weit verbreiteten Annahmen, nicht in erster Linie auf der überlegenen europäischen Waffentechnik beruhte, sondern „häufig darauf, Einheimische zu rekrutieren und gegen andere Einheimische kämpfen zu lassen. Die militärische Überlegenheit durch moderne Feuerwaffen oder Flugzeuge wurde erst relativ spät wirksam, und vor allem in Verbindung mit der Nutzung örtlicher Hilfstruppen“ (110 f.).
Im direkten Vergleich mit den europäischen Kriegen waren Kolonialkriege durchgängig brutaler und führten zu vergleichsweise höheren Opferzahlen. „Im Kolonialismus ging es darum, eine unterworfene Bevölkerung an Rebellionen und Aufständen zu hindern oder diese niederzuschlagen. Kolonialismus implizierte die gewaltsame Sicherung von Fremdherrschaft – deshalb war ein Versuch, die Bevölkerung für sich zu gewinnen, insgesamt wenig aussichtsreich.“ (181 f.) An seiner Stelle sei meist eine Politik des Teilens und Herrschens, des gegeneinander Ausspielens unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen, getreten. Das Erbe dieser Zeit ist heute bei vielen ethnischen und konfessionellen Konflikten in ehemaligen Kolonialländern sichtbar.
Im 21. Jahrhundert ist indes die Tendenz zu einer Verschmelzung von zwischenstaatlichen und Bürgerkriegen sowie einer Fusion konventioneller und unkonventioneller Kriege. Diese wandeln sich immer schneller und aus gewaltlosen Aufständen können leicht gewaltsame Bürgerkriege und regionale Konflikte erwachsen. „Krieg […] ist kein Zustand, sondern ein Prozess.“ (259)
Neben dieser historischen Verortung beleuchtet Hippler die Kriegstheorie und startet – wie könnte es anders sein – bei Carl von Clausewitz. Er betont, korrekt, dass dieser meist falsch zitiert und verstanden werde. So stellte von Clausewitz bereits 1832 fest: „Krieg sei keine Kunst und ebenso wenig eine Wissenschaft“, er sei „noch am ehesten mit dem Handel vergleichbar, entspringe dem gesellschaftlichen Verkehr – woraus zahlreiche Unwägbarkeiten resultieren.“ (30) Aufgrund der vielen Unwägbarkeiten stellt von Clausewitz fest: „Man fängt keinen Krieg an, oder man sollte vernünftigerweise keinen anfangen, ohne sich zu sagen, was man mit und was man in demselben erreichen will, das erstere ist der Zweck, das andere das Ziel.“ (30)
An dieser Stelle wird Hippler bereits – zurecht – politisch und betont den Kontrast moderner Kriegsrhetorik zu den Einsichten von Clausewitz: „Und anstatt solche Kriege in den Dienst konkreter, realistischer und durchdachter Ziele zu stellen, werden wohlklingende, aber leere Phrasen zu Zielen, gar zur Strategie erklärt, die so vage sind, dass weder Militärs noch Zivilisten sagen können, was sie tatsächlich operativbedeuten. ‚Frieden‘, ‚Stabilität‘ oder der ‚Aufbau von Staatlichkeit‘ sind wunderbar – aber als Grundlage der Strategieentwicklung sind sie viel zu allgemein und unbestimmt, und kaum besser als für das Gute und gegen das Böse zu sein.“ (35)
Auch die Rolle von Religionen wird untersucht und Hippler stellt fest, dass Religionen ein beträchtliches Potenzial zur Gewaltverherrlichung und Rechtfertigung in sich tragen – auch wenn dieses nicht immer zum Ausbruch kommen muss. „Eine Deformation des Denkens und Fühlens in Richtung auf die Bereitschaft der Vernichtung der anderen entsteht selten aus theologischen Erwägungen heraus, sondern als Reaktion auf gesellschaftliche und politische Bedingungen, die dann theologisch, pseudotheologisch oder kulturell verdaulich gemacht wird.“ (78) Entsprechend muss der Fokus der Analyse auf der Frage liegen, wann und unter welchen Umständen Religionen zur Rechtfertigung und für Begünstigung von Gewalt neigen.
Alle diese Kapitel sind gut, informativ und logisch nachvollziehbar geschrieben. Der tatsächliche Schwerpunkt und auch die Stärke des Buches liegen in der Analyse und Bewertung der historischen Erkenntnisse sowie deren Vergleich mit aktuellen Entwicklungen und den politischen Reaktionen darauf. Was allerdings die Fähigkeit von politischen und militärischen Entscheidungsträgern zum Lernen aus historischen Fehlern angeht, ist Hippler – zurecht – sehr kritisch: „Die Weigerung, aus negativen Erfahrungen zu lernen – bzw. die Tendenz, Lehren schneller zu vergessen als zu ziehen – mag nicht typisch für das Militär sein, sondern ist den meisten Großbürokratien nicht fremd.“ (121)
Afghanistan ist hierfür ein Musterbeispiel, in dem die Erfahrungen vorhergehender ausländischer Interventionen wenig bis gar nicht zur eigenen Strategiebildung herangezogen wurden. „Im internationalen Afghanistan-Einsatz konnte man dieses Problem Jahre lang intensiv studieren: Vage und wohlklingende politische Phrasen waren kein Ersatz für eine klare Zielbestimmung. Dazu kommt offensichtlich noch das Problem, dass bei unklarer oder fehlender Zielbestimmung die Überprüfung der Zielerreichung kaum möglich ist. Im Krieg aber nicht beurteilen zu können, ob man den eigenen Zielen überhaupt näher kommt, führt zu Desorientierung und – wie im Vietnamkrieg – dazu, dass das Militär sich rein technische und irreführende Maßstäbe des Erfolges sucht, wie etwa die Zahl getöteter Feinde.“ (126)
Die Angst vor schlechter Presse führte zudem dazu, dass die politische und militärische Führung sich immer weiter von der Auftragstaktik – der eigentlichen Führungsphilosophie der Bundeswehr – entfernte. „Unter Kriegsbedingungen zu versuchen, aus einer oft fernen Hauptstadt durch die zivile Führung entscheiden zu wollen, wie genau das Militär die ihm gesetzten Ziele operativ zu erreichen hat, führt im günstigsten Fall zu Reibungsverlusten und Ineffizienz, im schlimmsten zum Scheitern.“ (125)
Gerade die militärische Führung sieht Hippler in der Pflicht, aus ihrer Fachlichkeit heraus die politische Führung zu beraten und klare sowie erfüllbare Zielvorgaben zu verlangen. Hierzu führt er aus: „Einmal besteht die Gefahr, dass das Militär seine Rolle aus Feigheit oder Unfähigkeit zu zurückhaltend interpretiert und seine Funktion nicht erfüllt, die politische Führung in militärischen Dingen zu beraten. Falls etwa die Politik dem Militär Ziele setzt, die nicht – oder nicht mit den zur Verfügung stehenden Mitteln – erreichbar sind, dann sollte man von einem kompetenten Militär erwarten, dies der politischen Führung deutlich zu sagen. Falls die politische Führung die Ziele eines Militäreinsatzes oder Krieges im wohlklingend Unbestimmten belässt (zum Beispiel irgendwo ‚Frieden‘ oder ‚Stabilität‘ herzustellen), dann sollte ein verantwortliches Militär hartnäckig nachfragen, was diese Phrasen denn konkret und praktisch bedeuten sollen. Ist es für die Herstellung von ‚Stabilität‘ nötig, eine Opposition niederzuschießen, oder wäre eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage dazu geeignet? Meint Stabilität, eine Diktatur zu unterstützen, wenn deren Existenz oder Verhalten die Quelle der Instabilität ist? Oder müsste man sie gerade überwinden? Ist für solche Aufgaben das Militär überhaupt das richtige Mittel oder würde ein Militäreinsatz die Probleme noch vergrößern? Verfügt das Militär über die nötigen Mittel, Kompetenzen und Konzepte, um solche ihm gestellten Aufgaben zu erfüllen? Je vager oder unkonkreter eine politische Führung die Militärziele setzt, desto wichtiger wäre es, dass das Militär seine Beratungsaufgabe selbstbewusst und kompetent wahrnimmt. Man dient seinem Land nicht durch Duckmäusertum, wenn dieses im Begriff steht, sich konzeptionslos in ein vielleicht sinnloses militärisches Abenteuer zu stürzen.“ (127)
Unter diesen Rahmenbedingungen analysiert Hippler schonungslos das Scheitern der aktuellen Aufstandsbekämpfungseinsätze und zeigt, dass dieses Scheitern bereits mit der Wahl der falschen Mittel beginnt. „Moderne Autoren zu Counterinsurgency betonen deshalb nicht ohne Grund die Notwendigkeit, die Bevölkerung für sich zu gewinnen und den Aufständischen zu entfremden. Darüber hinaus, und um diese Ziele zu erreichen, wird die Schaffung und Stärkung legitimer Regierungsführung ins Zentrum gerückt. Dieser eigentlich richtige Ansatz zieht jedoch eine Reihe konzeptioneller und praktischer Probleme mit sich. Eine Schwierigkeit besteht in der Tatsache, dass Soldaten von ihrer Ausbildung und Kultur her zuerst Kämpfer sind, keine Sozialarbeiter oder politischen Reformer. Wer Soldaten den Auftrag erteilt, für eine fremde Regierung in einem ihm unbekannten Land ‚Legitimität zu schaffen‘, sollte sich nicht zu viel davon versprechen.“ (182)
Militärisch sind solche Konflikte nicht zu lösen, ohne dass die Interventen wesentliche Elemente ihrer Staats- und Menschenrechtsphilosophie opfern. „Nur wenn eine Regierung bereit und in der Lage ist, die eigene Gewalt gegebenenfalls bis zum Völkermord zu steigern, schafft militärische Vernichtungskraft eine Chance, unkonventionelle und innergesellschaftliche Kriege gewaltsam zu entscheiden. Sobald eine Regierung zu einem solchen exzessiven Maß an Gewalt nicht bereit oder in der Lage ist, wird über Sieg oder Niederlage in innergesellschaftlichen Kriegen nicht militärisch, sondern durch politische Faktoren entschieden.“ (174) Dies haben militärische und politische Entscheidungsträger erkannt, das Problem bestehe nur darin, schreibt Hippler, dass Soldaten also paradoxerweise die falschen Akteure sind. „Sie können Voraussetzungen schaffen, Zeit gewinnen, politische und ökonomische Prozesse schützen – aber diese Prozesse kaum jemals selbst zu Stande bringen. Die Schaffung von Legitimität und das Gewinnen der Bevölkerung sind keine primär militärischen, sondern zivile Aufgaben. (183)
Dieser Herausforderung begegnen moderne Interventen mit einem vernetzten Ansatz militärischer und ziviler Mittel wie humanitärer oder Entwicklungshilfe. Werden diese Maßnahmen aber in den Dienst der Politik und der Aufstandsbekämpfung gestellt, attestiert Hippler, dass „oft die humanitäre Wirkung weniger wichtig ist als die politische oder symbolische Bedeutung eines Einsatzes“ (210).
Da jede Form der Aufstandsbekämpfung aber konterrevolutionär ist, startet sie in jedem Fall mit einem Malus: „Aufstand oder Guerillakrieg sind Mittel der radikalen sozialen oder politischen Veränderung; sie sind das Gesicht und die rechte Hand der Revolution. Die Absicht des Konterrevolutionäres ist negativ und defensiv. Er will mit Waffengewalt die Ordnung wiederherstellen, Eigentum beschützen, existierende Formen und Interessen bewahren, wenn Überzeugung schon gescheitert ist. Seine Mittel können politisch sein, sofern Sie noch weitere Überzeugungsversuche beinhalten – das Versprechen sozialer und ökonomischer Reformen, materielle Vorteilsgewährung oder verschiedene Formen der gegen Propaganda. Aber die wichtigste Aufgabe der Aufstandsbekämpfung muss vor allem darin bestehen, die Revolution zu zerstören, indem man die Hoffnung auf sie zerstört – also militärisch zu beweisen, dass sie nicht erfolgreich sein kann.“ (212)
Zum Abschluss streift Hippler noch die philosophische Frage, wie und warum sich Menschen auf die eine oder andere Art gegenüber dem Krieg als Phänomen positionieren und er schließt mit einem Satz, den sich viel politische Entscheidungsträger zu Herzen nehmen sollten: „Es ist schließlich das Ergebnis einer nüchternen Bestandsaufnahme, dass die große Mehrheit der Kriege der letzten Jahre ohne erkennbare Strategie orientierungslos und improvisiert geführt wurden. Solche Kriege abzulehnen erfordert nur Vernunft, keine pazifistische Überzeugung.“ (297)
{Bid=40487}Die Themen Krieg und Terrorismus sind aus den täglichen Nachrichten kaum noch wegzudenken. Michael Wolf legt zu diesem Komplex nun nicht nur einfach ein weiteres Buch vor, sondern ergänzt den Blick darauf um eine dringend benötigte Perspektive: Welche langfristigen und generationenübergreifenden Auswirkungen haben diese Gewalterfahrungen – ob aus erster Hand oder medial vermittelt – auf die Politik und die Psyche der Menschen? Diese Fragen werden aus psychoanalytischer Sicht betrachtet und dabei die psychologischen Folgen mit Blick auf ganze Bevölkerungen in den Blick genommen.
zur Rezension
Aus der Annotierten Bibliografie